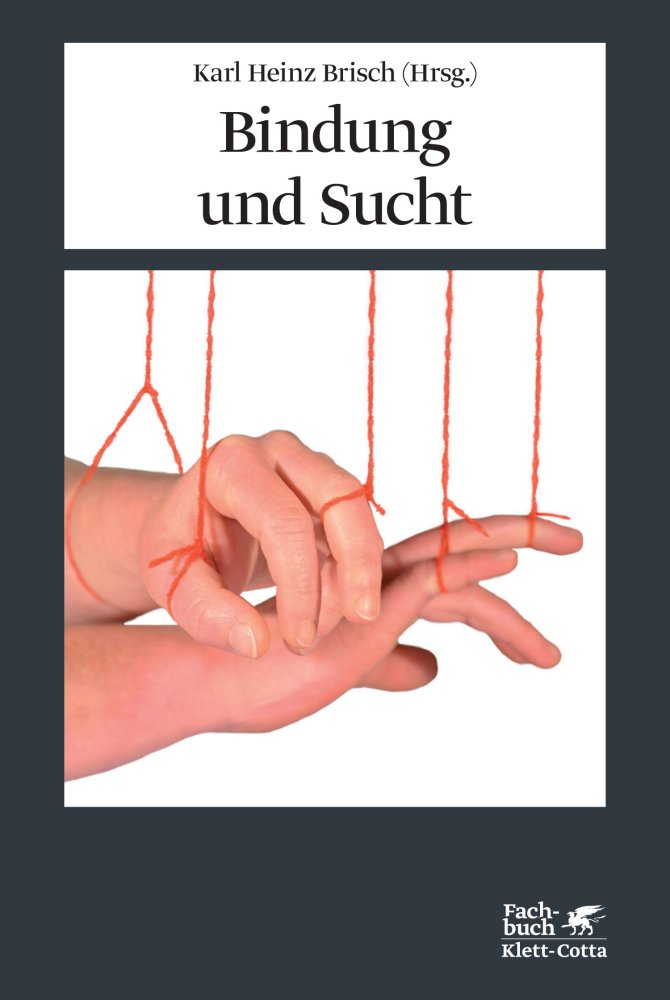![Bindung und Sucht]()
Bindung und Sucht
Funktionen notwendig ist?
Reorganisation der Identität: Wird sie in der Lage sein, ihre Selbstidentität so zu transformieren, dass sie diese Funktionen unterstützt und fördert?
Es liegt auf der Hand, dass es für Mütter mit einer Drogenproblematik eher schwieriger ist, diese Themen in für sie befriedigender Weise zu füllen, als für andere. Mittels unterschiedlicher Testverfahren wurden daher bedeutsame Einstellungen und Haltungen der untersuchten Mütter erfasst und zu den Ergebnissen der Interaktionsbeobachtungen in Beziehung gesetzt.
Drogenabhängigkeit und Elternschaft
Drogenabhängige Frauen mit ihren Kindern sind in ihrer individuellen wie dyadischen Entwicklung besonders gefährdet und dabei nicht leicht zu erreichen. Erst seit wenigen Jahren werden die Politik (Bühring 2007), die Kinderärzte (Wygold et al. 2006) und die Soziale Arbeit auf diese Klientel aufmerksam. Heute haben insgesamt 46 % der ca. 20 000 opiatabhängigen Frauen in Deutschland mindestens ein Kind (30 % bei niedrigschwelligen Angeboten, 50 % bei Substitutionsbehandlung). Ca. 50 % dieser Kinder leben mit ihren Müttern zusammen. Insgesamt gibt es in unserem Land ca. 40 000 Kinder drogenabhängiger Eltern (Klein 2001). Während die Kinder im Schulalter zunehmend von Beratungs- und Unterstützungsangeboten profitieren können, gibt es immer noch nur wenige Einrichtungen, die für Schwangere und Mütter mit ihren Säuglingen ein tragfähiges Hilfekonzept bereithalten.
Zudem ist die Forschungslage zur Beziehungsgestaltung und postnatalen Entwicklung bei Müttern, die von illegalen Suchtmitteln abhängig sind, und ihren Babys dünn (Hogan 1998). Eine kleine Studie zur interaktivien Kapazität vonzwölf gemischt alkoholkranken und drogenmissbrauchenden Müttern von Säuglingen – inkl. Kontrollgruppe – legte M. Pajulo (Pajulo et al. 2001) aus Turku, Finnland, vor.
Suchman et al. (2006) fanden in der internationalen Literatur insgesamt sechs Studien, die eine Verbesserung des Elternverhaltens bei drogenabhängigen Müttern zum Ziel hatten, nur zwei davon mit einer im engeren Sinne beziehungsorientierten Perspektive.
Säuglinge opiatabhängiger Mütter
Während ihrer prä- und postnatalen Entwicklung sind Kinder opiatabhängiger Mütter einer Reihe von potenziellen Risiken ausgesetzt, die sich sehr unterschiedlich auswirken können; Risikofaktoren sind:
1.) Biologische Risikofaktoren:
transplazentare Drogenexposition mit Gefährdung der Entwicklung des Zentralnervensystems, insbesondere Gefahr durch Nikotin und Beikonsum wie Alkohol und Kokain, das ja auch eindeutig teratogene Wirkung hat (vgl. Stachowske 2008);
Mangelernährung und Wachstumsstörungen, Frühgeburtlichkeit, ebenfalls v. a. durch Nikotin und ausgeprägten Beikonsum;
eine hohe Prävalenz von Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis;
perinatale Komplikationen, Gefahr des SID (plötzlicher Kindstod);
neonatales Entzugssyndrom (NAS) durch intrauterin erworbene körperliche Abhängigkeit (Wygold et al. 2006), häufige postnatale Hyperexzitabilität, Hypotonus, Reflexanomalien. Diese bilden sich in der Regel im ersten Lebensjahr vollständig zurück.
Bis in die jüngste Vergangenheit hinein galt, dass die biologischen Risikofaktoren – anders als bei Kindern alkoholabhängiger Mütter – insgesamt weniger ins Gewicht fallen, da Opioide nicht zytotoxisch und nicht teratogen wirken. Insbesondere Missbildungen und syndromatische Schäden wie bei der Alkoholembryopathie sowie bleibende zerebrale Schäden wurden praktisch nicht beobachtet. Allerdings weisen Steinhausen et al. (2007) in einer Schweizer Studie darauf hin, dass Kinder drogenabhängiger Mütter vermehrt schlechtere Intelligenzleistungen erbringen als die Normalpopulation; dabei wurden alle anderen Risikofaktoren außer der pränatalen Heroin-/Methadon-Exposition herausgerechnet.Stachowske (2008) macht darauf aufmerksam, dass eine pharmakologische Definition der in der Regel polytoxikomanen Konsummuster nicht möglich ist und damit eine medizinische »State-of-the-Art«-Hilfe kaum beschrieben werden kann.
Mittlerweile liegen tierexperimentelle Forschungsergebnisse vor, die belegen, dass eine Opiatexposition bei Föten die Migration und das Überleben von Neuronen während der Hirnentwicklung negativ beeinflusst. Auch wurden Gedächtnisstörungen bei Mäusen als Folge neuronaler Apoptose (Zelltod) beobachtet. Aufgrund der beim Menschen ausgeprägten Interdependenz von psychosozialen und von genetischen Faktoren
Weitere Kostenlose Bücher