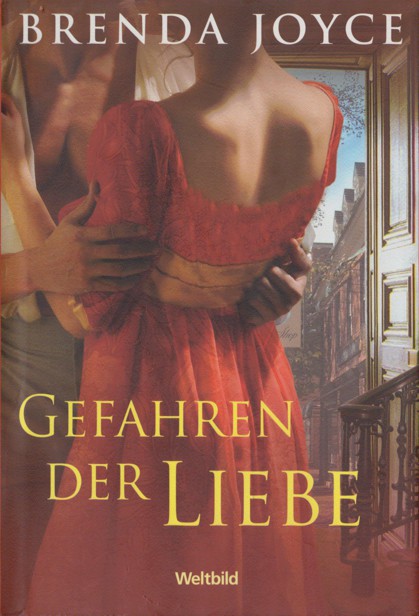![Brenda Joyce]()
Brenda Joyce
unweigerlich Scham
einschleichen, denn unser Geheimnis würde nicht lange unentdeckt bleiben.« Er
legte ihr eine Hand an die Wange. »Wie lange würdest du mich noch lieben, wenn
dich erst einmal die Scham überkommt?«
Sie riss sich von ihm los und verschränkte die Arme fest vor der
Brust, so fest, dass ihr das Atmen schwer fiel. Oder vielleicht hatte sich die
Luft verändert, war dick und ungenießbar geworden, oder vielleicht war es noch
etwas anderes.
»Und wie würdest du dich fühlen, wenn du eines
Tages als meine Mätresse meiner Frau gegenüberstündest?«, fragte er weiter.
»Hör auf!« Seine Worte drangen wie
Messerstiche in ihr Herz. »Ich habe es dir bereits gesagt: Ich achte dich viel
zu sehr, als dass ich dich behandeln könnte, wie andere Männer eine Georgette
de Labouche behandeln oder eine Daisy Jones«, setzte Bragg sanft hinzu. »Weine
nicht. Du hast es nicht verdient, dass ich dich geringer achte. Und was ist mit
Andrew? Großer Gott, er ist mein Freund. Ich respektiere und bewundere deinen
Vater, Francesca. Ich könnte ihn niemals hintergehen, indem ich seine Tochter
auf solche Weise benutze.«
Alles, was er gesagt hatte, stimmte, und gerade darum schmerzte
es so sehr. »Und was wird nun aus uns?«, fragte sie. »Was, Bragg? Wenn ich
nicht zulassen kann, dass du dich von deiner Frau scheiden lässt, und du mich
nicht zur Mätresse nimmst, wie geht es dann mit uns weiter? Was sollen wir
tun?«
Er starrte sie an und ließ ihre Hand los. Eine unsägliche Trauer
überschattete sein Gesicht und verdüsterte seinen Blick. »Ich weiß es nicht.
Unsere Freundschaft ist zu einer Unmöglichkeit geworden.«
»Nein«, hauchte sie entsetzt.
Er hielt ihrem Blick schweigend stand.
»So darfst du nicht denken!« Er konnte nicht gemeint haben,
sie sollten ihre Freundschaft beenden. »Wenn ich eines nicht zulassen werde,
dann, dich als Freund zu verlieren. Diese Möglichkeit besteht einfach nicht,
Bragg!«, stieß sie verzweifelt hervor.
»Wir sollten nicht mehr miteinander allein sein«, entgegnete er
nüchtern. »Das weißt du selbst.«
Sie starrte vor sich hin, ohne ihn recht wahrzunehmen – Tränen verschleierten ihre Sicht. »Ich gehe jetzt besser
hinein«, sagte sie steif. »Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast.« Er
nickte und begleitete sie bis zur Haustür, ohne sie jedoch noch einmal zu
berühren.
Als er fort war, starrte Francesca stumpf aus einem Fenster auf
die verlassene, verschneite Straße hinaus. Eine entsetzliche Angst hatte von
ihr Besitz ergriffen.
Das alles
konnte nicht wahr sein.
SONNTAG, 16. FEBRUAR 1902 – 9 UHR
»Alles wie immer«, stellte Joel Kennedy stirnrunzelnd fest. »Keine
Sturmflut, kein Hurrikan.«
Sie waren soeben aus einer Mietdroschke
gestiegen und standen nun vor dem Polizeipräsidium. Joel war offensichtlich
enttäuscht, dass in der Zwischenzeit keine Naturkatastrophe das rötlich braune
Sandsteingebäude dem Erdboden gleichgemacht hatte. Die Mulberry Street war
gespenstisch menschenleer, was jedoch an einem Sonntag und zu solch früher Stunde
nicht weiter erstaunlich war. Francesca vermutete, dass die meisten der
zwielichtigen Gestalten, die sich sonst hier herumtrieben, bis in die
Morgenstunden hinein auf den Beinen gewesen waren. Braggs Wagen stand nicht vor
dem Gebäude, wie sie erleichtert feststellte.
Nach dem furchtbaren Ausgang des vorigen Abends hätte sie ihm
jetzt unmöglich gegenübertreten können. Noch immer fiel es ihr schwer, einen
klaren Gedanken zu fassen – sie wusste nur, dass sie ihn liebte und dass sie
irgendwie eine Lösung für das furchtbare Dilemma finden würden, in dem sie
steckten.
Es war bitterkalt. Über Nacht war die Temperatur auf etwa dreizehn
Grad unter null gefallen, und der Tag versprach nicht viel wärmer zu werden.
»Lass uns hineingehen«, sagte Francesca bibbernd. Dann erkundigte sie sich:
»Wie gefallen dir deine neuen Handschuhe und die Mütze?«
Während sie an zwei uniformierten Polizisten vorbeigingen, die sie
gar nicht zu bemerken schienen, erwiderte Joel grinsend: »Richtiges Leder und
mit Wolle gefüttert. Gefallen mir ganz toll, Miss Cahill. Danke.«
Sie lächelte ihn an. »Mit Kaschmir
gefüttert«, korrigierte sie. Bisher hatte Joel seine Hände mit Lumpen
umwickeln müssen, um sie vor der Kälte zu schützen. Sie hatte ein Dienstmädchen
beauftragt, eine Mütze und Handschuhe für den Jungen zu kaufen.
»Kaschmir?« Er riss die Augen so weit auf, dass sie ihm schier aus
dem Kopf zu fallen
Weitere Kostenlose Bücher