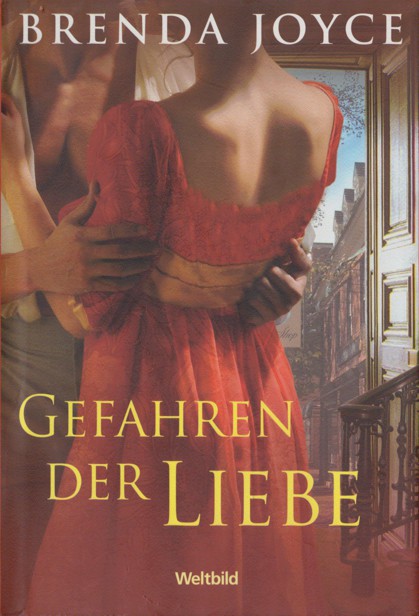![Brenda Joyce]()
Brenda Joyce
Kapitel 1
FREITAG, 14. FEBRUAR 1902 – 10 UHR
Sobald Francesca Cahill erwacht war, dachte sie darüber nach, wie sie
sich aus dem Haus stehlen könnte. Sie hatte die Angewohnheit, zu geradezu
unschicklich früher Stunde aufzustehen – jedenfalls warf ihre Mutter ihr das
vor. Allerdings war Julia Van Wyck Cahill, eine der angesehensten Damen in den
vornehmen Kreisen New Yorks, buchstäblich ein Muster an Schicklichkeit.
Francesca jedoch gab sich keinerlei Illusionen hin – sie selbst war nicht nur
durch und durch ein Blaustrumpf und eine radikale Reformistin, sondern wusste
auch recht gut, dass man sie hinter ihrem Rücken mitunter als exzentrisch
bezeichnete. Doch das kümmerte sie nicht. Sie gab ohnehin nichts auf Mode,
Empfange, Einkaufsbummel oder Teegesellschaften. Vor einiger Zeit hatte sie
sich heimlich am Barnard College eingeschrieben und gehofft, nach dem Abschluss
ihres Studiums in die Fußstapfen ihres Idols zu treten: des Journalisten und
Reformisten Jacob Riis. Doch im vergangenen Monat – seit dem 18. Januar, um
genau zu sein – hatte das Schicksal ihre Pläne durchkreuzt.
Alles hatte damit begonnen, dass der sechsjährige Nachbarssohn
entführt wurde. Francesca Cahill war diejenige gewesen, die das eigentümliche
Schreiben, das man nicht wirklich als Erpresserbrief bezeichnen konnte,
entdeckte. Vor allem aber hatte sie entscheidend dazu beigetragen, die
Ermittlungen der New Yorker Polizei voranzubringen, und den Fall letztendlich
mit aufgeklärt. Dabei hatte sie sehr eng mit dem neuen Polizeipräsidenten der
Stadt, Rick Bragg, zusammengearbeitet.
Lächelnd blieb Francesca in der riesigen Eingangshalle ihres
Elternhauses stehen. Das Haus war vor acht Jahren erbaut worden und wurde von
der Presse als »der Marmorpalast« bezeichnet. Dort traf sie auf den neuen
Dienstboten, der, soweit sie sich erinnerte, Jonathon hieß. Er war in ihrem
Alter, ebenso blond und blauäugig wie sie selbst, und erwiderte ihr Lächeln.
Eine Nachricht war vor fünfzehn Minuten eingetroffen, und zwar in
einem versiegelten, unbeschrifteten Umschlag, was an sich schon ungewöhnlich
war. Noch erheblich mehr Grund zur Beunruhigung gab der Inhalt der in nahezu
unleserlicher Schreibschrift hingekritzelten Botschaft. Er lautete:
Liebste
Francesca,
wir
brauchen dringend Ihre Hilfe! Kommen Sie unverzüglich.
Ihre Freundin
Mrs Richard Wyeth Channing
Bei der Absenderin handelte es sich um die Mutter der Verlobten von
Francescas Bruder. Offenbar war die Nachricht in großer Hast verfasst worden,
denn die Handschrift war so krakelig, als stammte sie von einem Kind, das
gerade erst schreiben gelernt hatte. Hinzu kam die Tatsache, dass der Umschlag
nicht mit Abigail Channings Namen und Adresse versehen war. Die Channings
mussten in ernsthaften Schwierigkeiten stecken, so viel stand für Francesca fest.
Doch inwiefern?
Sie wandte sich an den Dienstboten und sagte
so harmlos und beiläufig, wie sie es vermochte: »Jonathon, wenn Sie meine Mutter
sehen – könnten Sie es wohl unterlassen zu erwähnen, dass ich aus dem Haus gegangen bin?« Während sie sprach,
blickte sie sich schuldbewusst in der von gewaltigen, paarweise angeordneten
korinthischen Säulen flankierten Eingangshalle um, von der aus eine breite,
weiße Alabastertreppe zu den drei oberen Stockwerken emporführte. Francesca
hatte schwere Verbrennungen an der rechten Hand erlitten, als sie Maggie Kennedy
das Leben rettete – einer armen Näherin, mit der sie neuerdings eine Art
freundschaftlicher Beziehung angeknüpft hatte. Nun trug sie einen dicken
Verband und hatte die Anweisung, für eine ganze Woche das Bett nicht – oder nur
so wenig wie möglich – zu verlassen. Zwar wünschte auch sie selbst durchaus
nicht, sich eine Infektion zuzuziehen, doch gerade vor zwei Stunden hatte ihr
der Doktor mitgeteilt, die Wunde heile recht gut. Schmerzen verspürte sie
überhaupt nicht mehr.
Und wie hätte sie es ablehnen können, dem
Hilferuf jener Frau nachzukommen, die einmal die Schwiegermutter ihres Bruders
und damit für sie gewissermaßen eine zweite Mutter sein würde? Francesca war
nun sehr froh, dass sie an diesem Morgen ihr Laudanum nicht eingenommen,
sondern heimlich weggegossen hatte. Sie hegte den Verdacht, dass ihrer Mutter
nicht nur daran gelegen war, die Anweisungen des Arztes zu befolgen. Auch wenn
sie es nicht beweisen konnte, so argwöhnte sie doch, dass Julia mit dem
Laudanum das Temperament ihrer Tochter zu dämpfen und so zu verhindern hoffte,
dass
Weitere Kostenlose Bücher