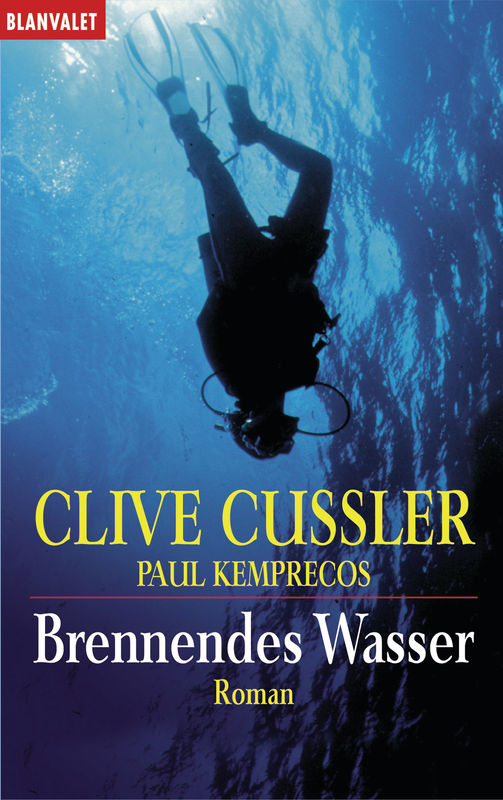![Brennendes Wasser]()
Brennendes Wasser
die Trouts, wie die Flammen sich durch die Bootsrümpfe fraßen. Die Flüchtlinge sicherten sich dadurch einen kleinen Vorteil, doch sobald die Eingeborenen die Sabotage bemerkten, konnten sie die Verfolgung trotz allem auf dem gut zugänglichen Uferpfad fortsetzen. Jeweils ein stärkerer und ein schwächerer Paddler taten sich zusammen, sodass Gamay und Francesca das eine Kanu besetzten, Paul und Tessa das andere. Sie schoben die Boote hinaus auf den Fluss und paddelten um ihr Leben. Nach einer Stunde legten sie am Ufer eine fünfminütige Rast ein, tranken einen Schluck und brachen sofort wieder auf, um sich weiter gegen die Strömung voranzukämpfen. Schon bald hatten sie Blasen an den Händen. Francesca ließ aus ihrer wundersamen Tasche eine Salbe herumgehen, die den Schmerz linderte. Dann legten sie sich sofort wieder ins Zeug, um vor Einbruch der Nacht so viele Meilen wie möglich zwischen sich und das Dorf zu bringen.
Die Dunkelheit kam viel zu schnell und machte die Fahrt auf dem Fluss erst schwieriger, dann unmöglich, weil die Kanus sich in dichtem Gras verfingen oder auf Sandbänke aufliefen.
Schon bald war jede weitere Anstrengung zwecklos. Sie gaben auf und paddelten näher ans Ufer heran, um dort ein Abendessen aus Dörrfleisch und getrockneten Früchten einzunehmen. Dann wollten sie ein wenig schlafen, aber die Einbäume eigneten sich kaum als Betten, und so waren die Fliehenden froh, als die Morgendämmerung hereinbrach.
Müde und mit steifen Gliedern setzten sie sich wieder in Bewegung. Der ferne Klang der Trommeln verlieh ihnen zusätzliche Kräfte und ließ sie ihre Schmerzen und Beschwerden ve rdrängen. Das unheilvolle Geräusch schien aus allen Richtungen zu ertönen und hallte durch den Wald.
Die Kanus glitten durch den Nebel, der aus dem Fluss aufstieg. Der Dunst schützte sie vor den Blicken der Chulo, aber er hemmte auch ihr eigenes Vorankommen, weil sie beständig auf unerwartete Hindernisse achten mussten. Als die Sonne aufging, schmolzen die Schwaden zu einem durchscheinenden Schleier zusammen. Da nun auch der Fluss vor ihnen wieder gut zu erkennen war, paddelten sie eifrig, bis das Dröhnen der Trommeln verklang. Sie blieben noch eine weitere Stunde in Bewegung und wagten keine Rast. Wenig später drang ein anderes Geräusch an ihre Ohren.
Gamay neigte den Kopf. »Hört doch«, sagte sie.
Aus einiger Entfernung erklang ein leises Donnern, als würde ein Zug durch den Wald rasen.
Francesca, die seit dem Beginn ihrer Flucht eine ernste Miene zur Schau getragen hatte, wagte ein leises Lächeln. »Die Hand Gottes winkt uns zu.«
Mit neuerlichem Schwung vergaßen sie Müdigkeit und Hunger, verdrängten das taube Gefühl in ihren Hinterteilen und tauchten die Paddel tief ins Wasser ein. Das Donnern wurde lauter, doch es konnte nicht das plötzliche Sirren übertönen, das wie die Schwingen eines Kolibris klang, gefolgt von einem deutlichen Pochen.
Paul schaute ungläubig nach unten. In der Seite seines Kanus steckte ein neunzig Zentimeter langer Pfeil. Nur ein kleines Stück höher, und das Geschoss wäre ihm in die Brust gedrungen. Er sah zum Ufer. Zwischen den Bäumen huschten blauweiße Gestalten umher. Der he ulende Schlachtruf hallte durch die Luft.
»Wir werden angegriffen!«, rief Paul, obwohl die Bemerkung völlig überflüssig war.
Überall um sie herum hagelten nun Pfeile ins Wasser. Sie zogen die Köpfe ein und paddelten wie wild. Die Kanus wurden schneller und schossen außer Reichweite der Schützen davon.
Ihre Verfolger kamen auf dem Uferpfad gut voran und schlossen bald wieder auf. An einer Stelle bog der Weg ein Stück in den Wald ein, und die Indios mussten sich durch dichtes Unterholz kämpfen, um freie Schussbahn zu erhalten. Sie versuchten es mehrere Male, doch die Einbäume konnten stets außer Reichweite der Pfeile ble iben. Sogar die mit Francescas Hilfe verbesserten Waffen hatten ihre Grenzen.
Es lag auf der Hand, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel sich bald zugunsten der Jäger wenden würde. Die Paddler waren zu Tode erschöpft. Immer öfter ließen sie einzelne Schläge aus und gerieten aus dem Takt. Als auch die letzte Kraft sie verließ, ha tten sie den Fluss soeben hinter sich gelassen und trieben nun auf dem See. Sie hielten einen Moment lang inne, um sich neu zu orientieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. Sie wollten die freie Fläche so schnell wie möglich überqueren und die Mündung des anderen Flusses ansteuern. Die dort undurchdringliche
Weitere Kostenlose Bücher