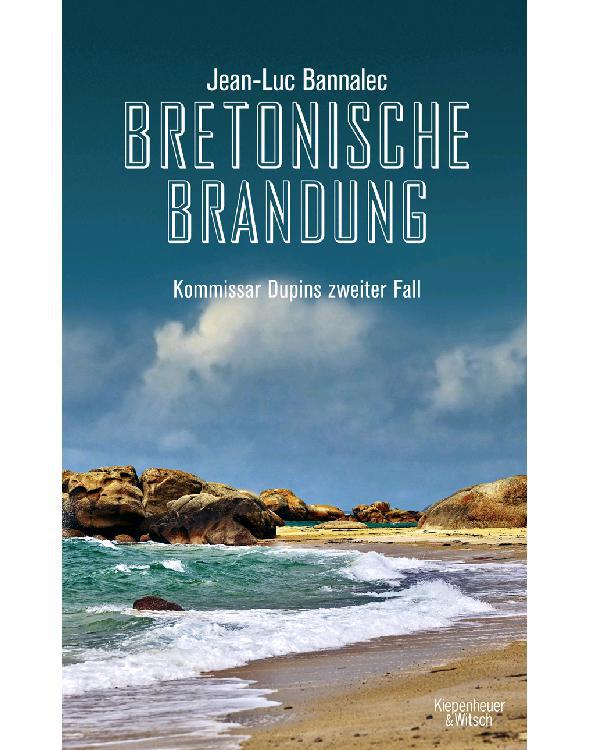![Bretonische Brandung]()
Bretonische Brandung
doch gestern Solenn Nuz gefragt, wo sie sich den Tag über aufgehalten hat.«
»Exakt.«
Le Coz war ein sehr gewissenhafter Polizist.
»Sie war in der Mairie von Fouesnant, hat sie Ihnen gesagt. Hat sie Ihnen erzählt, was sie dort gemacht hat?«
»Nein. Nur das, was ich Ihnen gesagt habe. Ich habe nicht nachgehakt, weil ich dachte, es ginge nur um die Frage, wo sie an diesem Tag zwischen halb eins und vier gewesen ist.«
»Das war richtig, Le Coz. Sie hat also nichts weiter darüber gesagt.«
»Nein. Nichts.«
»Können Sie versuchen, das bei der Mairie rauszukriegen?«
»Sofort, Commissaire.«
Dupin legte auf.
Er war an der Spitze der Insel angekommen. Oder genauer: Er war über die Spitze von Saint-Nicolas hinausgelaufen, über den an dieser Stelle plötzlich steinigen, miesmuschelbewachsenen Meeresboden, und auf ein ganz und gar winziges Inselchen gelangt. Eigentlich nur vierzig Meter entfernt von Saint-Nicolas, kaum mehr als zehn mal zehn Meter groß. Bei Ebbe war es ein kleines Anhängsel von Saint-Nicolas. Dupin war so in Gedanken gewesen, dass er erst jetzt bemerkte, wo er war. Umgehend machte er kehrt.
Ein weiteres Mal holte er sein Heft hervor, blätterte, fand, was er suchte, und wählte noch einmal Riwals Nummer.
»Chef?«
»Geben Sie mir noch einmal Le Coz.«
»Mache ich.«
Wieder das gleiche raschelnde Geräusch.
»Hat Madame Barrault Ihnen gesagt, was sie zwischen ihrem Mittagessen und dem Zeitpunkt gemacht hat, an dem ich sie am Quai getroffen habe?«
»Nein. Nur, dass sie zu Hause war. Allein. Das ließe sich also ohnehin nicht überprüfen.«
»Danke.«
Dupin legte wieder auf. Das war kein fruchtbares Telefonat gewesen. Er befand sich genau zwischen den beiden Inseln. Er bewegte sich sehr vorsichtig. Das war eine irre Vorstellung, die einen Menschen des sechsten Arrondissements schwindelig machen konnte: Er lief über Meeresboden. Hier schwammen sonst Fische. Wie die aus seiner Cotriade von gestern.
Dupins Handy klingelte. Es war eine Pariser Nummer. Zuerst hatte er kurz befürchtet, es sei seine Mutter. Aber er erkannte Claires Nummer. Einen Moment lang rang er mit sich. Dann nahm er ab. Und wusste sofort, dass es ein Fehler gewesen war. Er würde ihr sagen müssen, dass er jetzt keine Zeit zum Reden habe – und genau das musste er vermeiden. Dass er so wenig Zeit hatte, für Claire und für sie beide, das war das größte Problem zwischen ihnen gewesen.
»Bonjour, Georges. Störe ich?«
»Ich. Nein. Bonjour, Claire.«
»Danke für deine Nachricht. Das waren furchtbar hektische Tage, ich war nur im OP. Zwei Kollegen sind krank.«
»Kein Problem.«
Es entstand eine peinliche Pause. Claire ging davon aus, dass Dupin etwas mehr sagen würde. Endlich sprach sie weiter.
»Und was machst du? Wo bist du?«
Sie hatte von dem Fall offensichtlich noch nicht gehört. Claire schaute nicht häufig Nachrichten.
»Ich bin auf einem Archipel, achtzehn Kilometer vor der Küste. Ich stehe zwischen zwei Inseln auf dem Meeresboden, gerade ist Ebbe. Hier sind überall Miesmuscheln, die du so liebst. Ich laufe drüber.«
Er hatte all diese Dinge gesagt, weil er keine Ahnung hatte, wie er die Situation lösen sollte. Er überlegte sogar kurz, ob er von den Delphinen erzählen sollte.
»Das klingt großartig. Machst du einen Ausflug?«
»Ich«, es ging nicht anders, er kam nicht umhin, es zu sagen, »ich bin in einem Fall.«
»In einem Fall auf einem Archipel?«
»Ganz genau.«
Es dauerte einen Moment, bis Claire verstanden hatte, was er sagen wollte.
»Dann hast du jetzt gar keine Zeit zum Reden.«
»Doch. Ich … Nein. Du hast recht. Aber ich rufe dich an, sobald der Fall gelöst ist. Dann haben wir richtig Zeit.«
»Ach so, ja«, wieder eine Pause. »Verstehe ich.«
Das war immer der schlimmste Satz gewesen.
»Ich will dich sehen.«
Das war ihm herausgerutscht. Und musste Claire sehr überraschen. Sie hatten ausgemacht, zusammen darüber nachzudenken. Ob sie sich sehen wollten.
»Was?«
»Ich bin mir ganz sicher. Ich will dich sehen.«
Dupin war die Flucht nach vorn angetreten. Seine einzige Chance. Aber vor allem: Es stimmte. Es war die volle Wahrheit.
»Gut.«
Das war ein echtes »Gut« gewesen. Er kannte es. Aus ihren glücklichen Zeiten. Die besten, die er je gehabt hatte.
»Dann sehen wir uns.«
»Gut.«
»Ich bin froh. Dass wir telefoniert haben. Das war ein – gutes Telefonat.«
Dupin war regelrecht beschwingt.
»Also – ruf mich an, wenn der Fall
Weitere Kostenlose Bücher