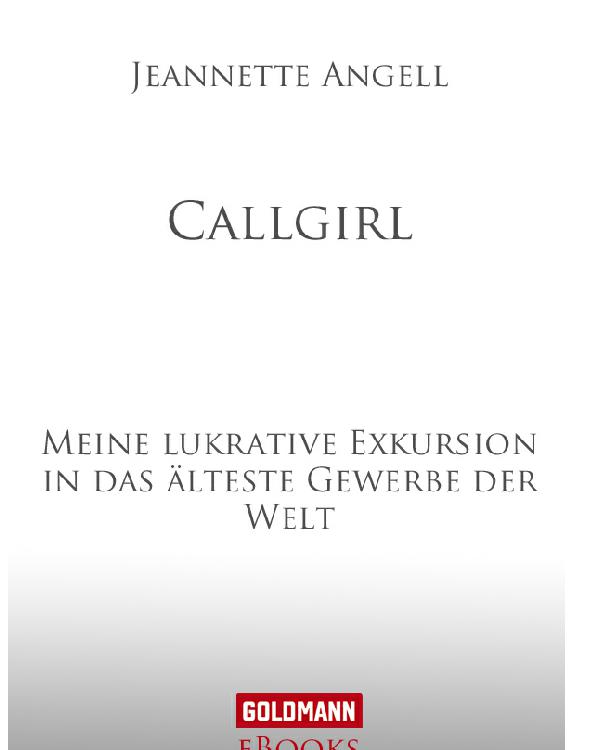![Callgirl]()
Callgirl
hielt. Ich ließ es dann doch bleiben.
Nach meiner ersten Woche bei Peach saß ich am Sonntagabend in meiner Wohnung, Scuzzy wohlig schnurrend an meiner Seite, und schrieb Schecks aus, um Rechnungen zu bezahlen, die seit ewigen Zeiten wie ein Damoklesschwert über meinem Kopf schwebten. Ich hatte bereits einen Teil des Geldes, den ich innerlich als »berufliche Aufwendungen« verbuchte, für meine neue Arbeitskleidung ausgegeben: ein paar schicke kleine Kostüme bei Next und Express, Wäsche von Cacique. Doch trotz dieser Extravaganzen konnte ich Rechnungen begleichen. Bald würde ich mich auch wieder ans Telefon trauen, statt sein Klingeln zu ignorieren, weil ich immer fürchtete, einen wütenden Gläubiger an der Strippe zu haben. Mein Magen würde sich nicht mehr panisch zusammenziehen, wenn ich den Briefkasten öffnete und mich fragte, wer mir nun schon wieder auf den Fersen war.
Zu sagen, dass ich mich gut fühlte, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts gewesen.
Man sah es auch. Ich strahlte ein neues Selbstbewusstsein aus. Vielleicht lag es an meinem neuen Nebenjob. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht mehr auf der ständigen Flucht vor Geldeintreibern durch die Gegend schleichen musste. Was immer der Grund gewesen sein mag, es fiel auch anderen auf.
Die Leiterin der soziologischen Fakultät, an der ich »Über Tod und Sterben« unterrichtete, sprach mich als Erste darauf an: »Neuer Freund, was?«
Ich hätte beinahe meinen Kaffee verschüttet. »Nein, Hannah, wie kommen Sie darauf?«
Sie schaute mich amüsiert an. »Sie sehen in letzter Zeit so gut aus. Richtig glücklich. Ehrlich gesagt habe ich gehört, wie Sie auf dem Klo vor sich hin gesummt haben. Da ist bestimmt ein neuer Mann im Spiel, hab ich mir gedacht.«
Falsch, Hannah. Nicht nur einer, sondern ganz viele. Jede Nacht ein anderer, um genau zu sein. Ich unterdrückte diesen Gedanken und ersetzte das blöde Grinsen, das er bei mir auslöste, durch meine seriöse Dozentinnenmiene. »Ich treibe mehr Sport in letzter Zeit, vielleicht liegt es daran.«
Der zweite Wahlkurs in Soziologie, den ich in diesem Semester unterrichtete, trug den Titel »Anstaltsleben«. In diesem Seminar ging es um die unterschiedlichen Methoden, mit denen medizinische und psychiatrische Institutionen – früher und heute – auf gut gemeinte, aber im Grunde grausame Weise mit psychisch Kranken umgingen. Wir hatten uns einige Sitzungen lang mit den so genannten »Palästen für die Armen« befasst, jenen riesigen staatlichen Nervenheilanstalten, die man im 19. Jahrhundert erbaute, um psychisch Kranke zu verwahren und so zu behandeln, wie man es zu jener Zeit für richtig hielt.
Am Tag nach meinem Einkaufsbummel und meiner Minibadekur ging ich innerlich aufgewühlt in meinen »Anstalts-Kurs« (wie er von dessen »Insassen« selbst genannt wurde) und mühte mich damit, meine Gefühle zu ordnen und zur Ruhe zu kommen. Wir steckten mitten in der Erörterung einer Frage, die ich bei der Untersuchung dieser Thematik immer wieder als besonders schwierig empfand, nämlich inwieweit unsere Gesellschaft solche Nervenheilanstalten quasi als Müllabladeplatz für unbequeme Frauen benutzt hat.
Ich musste mich in diesem Kurs zu einer distanzierten oder sachlichen Haltung zwingen, weil das Thema mich immer wieder in Rage brachte. Die lästige alte Jungfer, die aufmüpfige Ehefrau,
die alternde Mutter – alle konnten mühelos eingekerkert werden: Der Mann, der sie loswerden wollte, musste nur einen Arzt finden, der ihre geistige Unzurechnungsfähigkeit bescheinigte. Sobald das Opfer erst einmal auf diese Weise in die Anstalt gelangt war, konnte es nur wieder herauskommen, wenn der männliche Verwandte, der die Einweisung in die Wege geleitet hatte, seine Zustimmung erteilte, und nicht etwa durch die Unterschrift des behandelnden Arztes (oder auf Grund irgendwelcher Anzeichen geistiger Gesundheit).
Ich fand das einfach ungeheuerlich. Jedes Mal wenn ich daran denke oder darüber rede, spüre ich, wie mein Blutdruck steigt.
Die Studenten beschäftigten sich in jener Woche mit einem Buch von Geller und Harris, das den Titel Women of the Asylum trägt. Von daher hatten sie sich vermutlich eine Meinung über das Schicksal der Frauen gebildet, die Jahre oder sogar Jahrzehnte in Irrenhäusern eingesperrt waren und nicht verrückter waren als die Männer, die sie dorthin gebracht hatten.
Nicht verrückter, nur machtloser.
Ich hatte im Rahmen meiner neuen unabhängigen Forschungen
Weitere Kostenlose Bücher