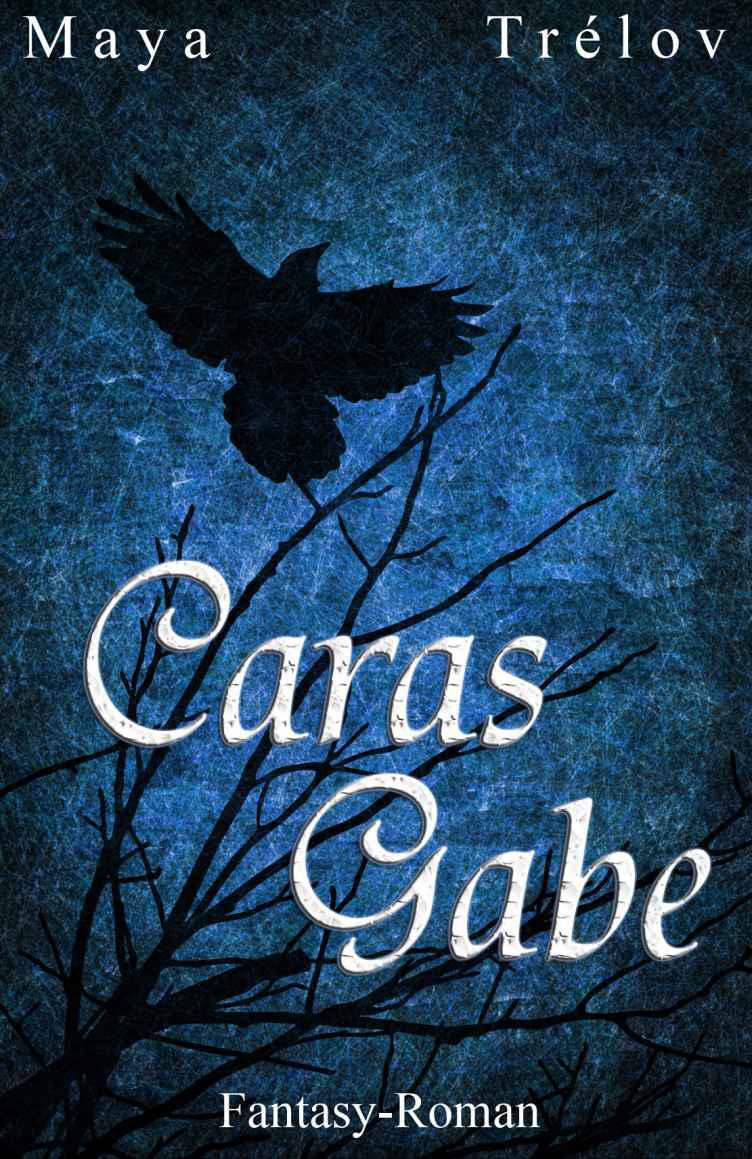![Caras Gabe]()
Caras Gabe
als zu schlucken.
Wasser rann mir aus Nase und Mund, ich bekam kaum noch Luft. Endlich ließen sie von mir ab. Wimmernd sackte ich zusammen und diesmal begrüßte ich die Schwärze, die sich über mein Bewusstsein breitete.
Das Nächste, das ich wusste, war, dass ich zurück zur Zelle geschleift wurde. Sie warfen mich hinein, als sei ich bereits tot. Schwere Ketten rasselten, dann fiel die Tür ins Schloss.
Ich lag bewegungslos da, mein Körper ein einziger schreiender Schmerz, der keine Tore zum Fliehen hatte und niemanden, der ihn hörte. Und alles, was ich wollte, war, dass diese bodenlose Schwärze kam und mich verschlang. Doch ich wartete vergebens.
Ein Geräusch drang durch meine Pein.
Da war etwas hinter mir. Es atmete mühsam, stöhnte und ächzte. Und es kroch auf mich zu.
Ich hatte keine Kraft mehr, um zu fliehen.
Etwas Schweres kam auf meiner Schulter zum Liegen. Es griff nach meinem Arm und zog. All meiner Kraft beraubt und unfähig festzustellen, ob dies eine Ausgeburt meiner Alpträume oder Wirklichkeit war, konnte ich nichts anderes tun, als erbärmlich zu zittern.
Ich schloss die Augen und suchte mich in mir. Einen Teil von mir, der so tief in mir begraben lag, dass ihn niemand sonst erreichen konnte. Ich wollte mich nicht verlieren. Ich hatte schreckliche Angst und Schmerzen und ich wollte auf keinen Fall in dieser kalten Zelle sterben. Ich wollte kämpfen.
Und wie aus dem Nichts tauchte ein Bild vor meinem geistigen Auge auf. Es war nicht, was ich erwartet hatte, nicht, was ich geglaubt hatte zu finden. Sondern etwas völlig anderes. Arane, meine Mutter, sah mich an und … sie lächelte. Auf ihre traurige, tapfere Art. Und in diesem Moment konnte ich zum ersten Mal begreifen, was sie dazu bewegt hatte, so zu handeln, wie sie gehandelt hatte. Sie hatte versucht mich zu beschützen. Vor Schmerzen, vor Angst und Tod. Nach dem Verlust meines Vaters war sie nur noch eine Hülle ihrer selbst gewesen, doch sie hatte niemals aufgehört, mich zu beschützen. Das begriff ich nun.
Eine eiskalte Hand legte sich um meine Kehle, das Pochen in meinem Schädel nahm zu. Meine Augen brannten. Nichts war, wie es sein sollte. Ich wünschte, ich könnte ihr sagen, dass es mir leid tat.
Das Wesen hinter mir ächzte erneut. Etwas umklammerte meinen Oberkörper. Ich bekam keine Luft mehr, brachte nichts als ein Wimmern zustande.
„Cara.“
Mir blieb fast das Herz stehen.
Er keuchte, nahm mich in die Arme und zog mich an seine Brust. Er trug keine Kleider mehr am Leib, seine Haut war eiskalt. Ich schauderte. Es war nass und klebrig bei ihm. Unter Schmerzen schaffte ich es, eine Hand vor mein Gesicht zu heben. Sie war schwarz. Blut. Ich badete in Aruns Blut.
„Nein.“ Eine Flut von Tränen brach aus mir heraus wie ein zu lange gestauter Fluss. Die Wogen schüttelten mich und zogen mich unter Wasser, bis ich fürchtete zu ersticken.
Arun hielt mich nur noch fester und wiegte mich sanft vor und zurück. „Shhhh“, hörte ich ihn. Seine Stimme klang, als habe man ihm Kiesel in die Kehle gegossen. „Ruhig, meine Cara“, flüsterte er rau, „ganz ruhig.“
Da war ein Ozean. Ein weites, unermessliches Meer aus öligem Schlick und kaltem Sand. Dort gab es kein Licht, kein Sehen, nur Haut und Knochen und die schiere Macht der Wellen, die sie aneinander rieben und ihnen Bewegungen abverlangten. Es war ein ewiges Treten und Beißen, ein Schwappen und Ersticken im Takt der Gezeiten. Ist dies das Leben?, fragte eine Stimme in mir. Ist dies der Tod?
Ich war allein in diesem brackigen Wasser, ohne Willen und ohne zu verstehen warum. Es schmeckte salzig und bitter. Es hatte mir meine Augen gestohlen und nun sank ich und sank, bis es keinen Boden mehr gab und keine Erinnerung an eine Oberfläche. Keine Fragen mehr.
Meine Hand schmerzte, pochte, biss und pulsierte im Auf und Ab der Wellen, die keine Wellen waren. Es dauerte langte, sehr lange, bis ich begriff, was dieser Schmerz bedeutete. Er bedeutete Verlust, unerfülltes Sehnen, einen ungelebten Wunsch. Ich sollte ein Schwert in dieser Hand halten, nicht die blutende Wunde einer gläsernen Feder.
Das goldene Glühen einer winzigen Münze stach durch die ölige Finsternis, kratze an meinen Augen wie die Elster an der Scheibe meines Fensters. Sie schwang durch das Dunkel, taumelte auf mich zu, denn auch diese Münze hatte keine Wahl. Sie war schwer, so schwer von meinem Wunsch, dass sie nur sinken konnte. Und sie zog mich mit sich hinab. Auf den Grund, zwischen
Weitere Kostenlose Bücher