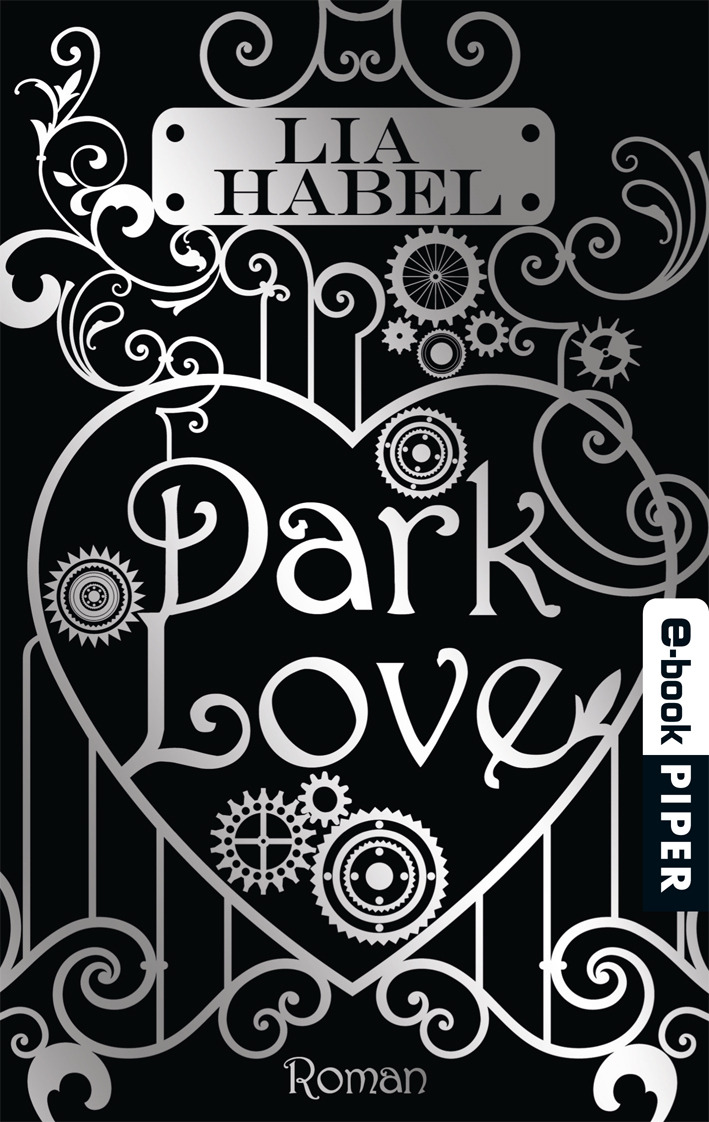![Dark Love]()
Dark Love
lesen.
»Mir ist aufgefallen, dass deine Stimme hauchiger klingt, wenn du nachdenkst. Mein Gehör ist sehr empfindlich. Einige unserer Ärzte glauben, wir hätten leicht geschärfte Sinne, da unsere Krankheit uns zu Jägern macht.«
»Und wenn man blind ist, hört man auch besser.«
»Was?« Ich war verwirrt. »Ich bin nicht blind.«
»Bist du nicht?«
Da begriff ich, was sie meinte. »Nein, nein. Nach dem Tod verschleiern sich bei fast allen die Augen. Bei mir ist es einfach nur etwas schlimmer. Ich kann aber gut sehen. Na ja, ziemlich gut jedenfalls. Es ist alles ein bisschen neblig, aber wenn ich mir so überlege, was ich schon alles sehen musste, ist das eigentlich sogar eine Verbesserung.«
»Du bist ziemlich … gelassen für jemanden, der tot ist.« Ihre Stimme klang ein wenig fester.
»Und ich finde, du bist sehr viel stärker, als wir alle zu hoffen gewagt haben.« Ich riss hier meine Klappe auf und erzählte ihr ständig Dinge, von denen sie nichts wissen sollte, und sie wurde mit allem fertig. Ich war wirklich beeindruckt.
Ich hörte, wie eines der Schlösser aufschnappte, dann noch eines. Langsam öffnete sich die Tür, soweit es die einzig verbliebene Sicherheitskette zuließ. Das Zimmer dahinter war dunkel und ich konnte nichts sehen außer ihrem von Tränen gezeichneten Gesicht, als sie sich in den Spalt beugte. Ihre dunklen Augen waren rot gerändert, aber sehr ernst.
»Dann ist mein Vater also ein Zombie?«
»Ja.«
Sie zwinkerte schnell und schluckte. »Und wo ist er dann?«
»Komm vom Fenster weg.«
Ich rührte mich nicht.
» Pamela Roe , du kommst sofort hierher.«
Zwei junge Reporter hatten am Vorabend ein Zelt vor unserer Tür aufgeschlagen und hielten ihre digitalen Notizbücher in freudiger Erwartung geöffnet. Einer von ihnen trug eine Kamera und hielt sie mit an Besessenheit grenzender Sturheit auf unsere Haustür gerichtet. Ich fragte mich, wie viele Reporter wohl Noras Tante Gene verfolgten.
Ich betrachtete sie mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und beißendem Abscheu. Ein Teil von mir wollte hinausstürmen und ihnen eine Show liefern, die sie so schnell nicht vergessen würden, ein anderer Teil wollte schreien, sich auf die Brust hämmern, sich die Kleider zerreißen und um die Rückkehr meiner besten Freundin betteln.
Der nächste Teil fühlte sich so taub an, dass die Welt wie in einem Traum vorbeiglitt. Nichts schien mehr von Bedeutung, da ja doch alles dem Verfall anheimfiel. Wir alle würden sterben, oder es würden schreckliche Dinge mit uns geschehen, was machte es also für einen Sinn? Was außer dem Wunsch nach einem echten Knüller hielt diese informationshungrigen Männer von ihren warmen Betten fern? Angst vor den Punks? Besorgnis um Noras Wohlergehen? Gier oder Ambition?
Ich war mir der Welt schrecklich schmerzhaft bewusst und schien ihr gleichzeitig völlig entrückt.
»Pamela!«
»Ja, Mutter.«
Langsam trat ich einen Schritt zurück. Der Saum meines Rocks strich über den Teppich. Ich hatte die Gardinen nicht aufgezogen, sondern die Reporter durch den Spalt zwischen ihnen beobachtet, durch den Innenvorhang aus durchscheinender Gaze. Durch einen Schleier.
»Du darfst dich nicht sehen lassen, Pamela«, mahnte meine Mutter. »Sonst machen sie ein Foto von dir und Gott weiß, was passiert, wenn dein Gesicht in den Nachrichten erscheint.«
Sie hatte natürlich recht. Ich hörte besser auf sie. Außerdem saß sie nur meinetwegen hier im Haus fest und war zur Untätigkeit verdammt. Meine Mutter, Malati, war eine robuste, starke Frau und normalerweise half sie meinem Vater in der Bäckerei. Seit Noras Verschwinden musste sie sich jedoch wie eine »respektable« Frau verhalten, was bedeutete, dass sie mit mir hier im Haus eingesperrt war.
Wir konnten niemanden besuchen. Wir konnten zwar Besucher empfangen, aber sie durften nicht lange bleiben. Wir durften nicht bei der Arbeit gesehen werden, welche Arbeit es auch immer war. Das vollkommene weibliche Herz hatte so empfindsam, so überwältigt von Schock und Trauer zu sein, dass die einzig angemessene Reaktion in einer Situation wie dieser aus apathischer Trauer bestand. Wenn man uns dabei erwischte, dass wir unser Leben einfach weiterlebten, würde man uns für merkwürdig, grausam und maskulin halten – und für mich wäre es der soziale Ruin.
Bevor ich nach St. Cyprian gekommen war, hatte es solche Regeln für uns nicht gegeben. Meine Eltern hatten den Stipendienantrag vor acht Jahren nur gestellt,
Weitere Kostenlose Bücher