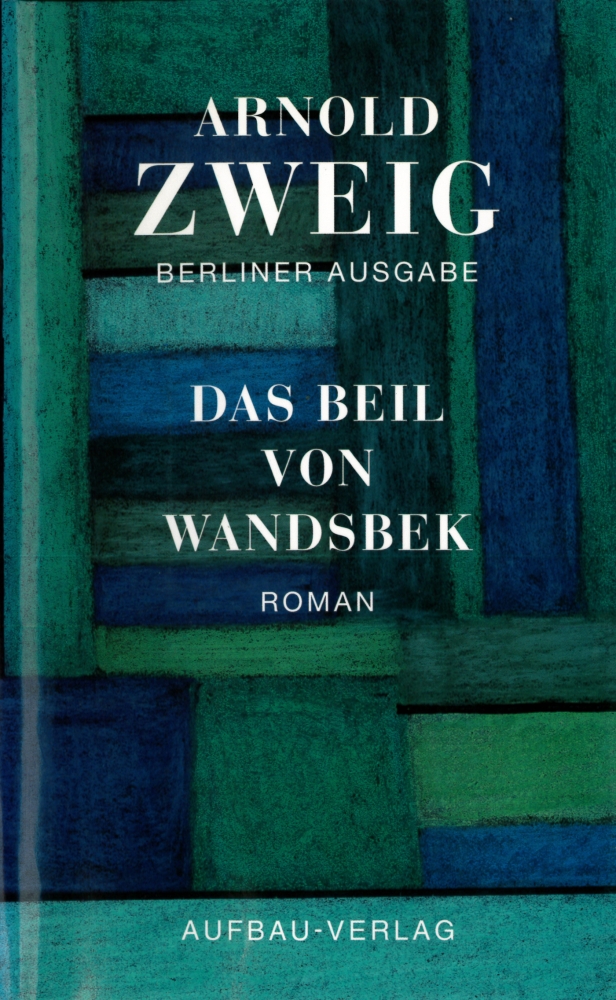![Das Beil von Wandsbek]()
Das Beil von Wandsbek
heute wie dunnemals.
Drittes Kapitel
Das Beil muß weg
In späteren Zeiten ward es Albert Teetjen klar, daß der Hochzeitssonntag des Kameraden Footh der letzte Tag war, an dem sich die wohlmeinende Täuschung, die sein Dasein bedeckte, aufrechterhalten ließ. Als sich am nächsten Tage keine Menschenseele ins Geschäft verirrte, ward ihm klar, daß da etwas geschehen sei. Breitbeinig saß er hinter seinem Ladentisch, wiegte seinen schweren Kopf und fühlte dumpfe und wirre Gedanken und Meinungen in ihm auf und ab wogen. Was war da los? War das erlaubt?Kränkte ihn jemand mit Absicht in seiner Existenz? Ging da ein Zufall vor sich? Daß jemand wagte, ihn zu boykottieren, dieser Gedanke lag ihm am fernsten. Den grauen und regnerischen Vormittag hindurch stritten in ihm die beiden Möglichkeiten, das Ganze sei Zufall oder aber Neid – Neid der Leute, denen er und Stine zu hoch gestiegen waren. Während dieses Hin und Her sortierte er die rosafarbenen und weißen Bons seiner Registrierkasse vom ganzen Jahre 37, um vor sich selbst und vor ihr noch immer so zu tun, als nehme ihn die Steuererklärung ganz in Anspruch. Am Nachmittag machte er in seiner Lederjoppe einen Gang durch die Wandsbeker Chaussee und viele Geschäftsstraßen in diesem Teil der Stadt. Die Berufskollegen klagten alle, aber irgend etwas hatten sie alle jeden Tag gelöst. So voll wie in den Warenhäusern war es bei ihnen ja nirgends, und wo immer Albert die Meinung vorbrachte, jemand müßte doch endlich an das unabänderliche Parteiprogramm erinnern und die Mitglieder der Innung an den Umsätzen der Lebensmittelabteilungen beteiligen, fand er Zustimmung, begeisterte, verdrossene oder spöttische. Und mehr als einmal hörte er, niemand sei besser berufen, sich da an die Spitze zu setzen als der Kollege Teetjen; ja einer, Schlächtermeister Kruse in der Kurzen Reihe, meinte, man werde bei den nächsten Wahlen erwägen müssen, ob man nicht den Kollegen Teetjen in die Bürgerschaft entsenden solle. Am Spätnachmittag oder Frühabend heimgekehrt, setzte er sich zu Stine in die Küche und fragte sie, ob sie denn schon was bemerkt habe. Natürlich hatte sie. Die Leute kamen nicht mehr. Auch die Hausbewohner blieben weg. Es sah schlimmer aus als in dem Halbjahr, bevor der Herr Footh seinen Einfall hatte. Was es sein konnte? Sie wußte es nicht, sagte sie. Trug sie in ihrem Kopfe eine Meinung umher, so verschwieg sie sie ihm jedenfalls. Da man bei diesem schlechten Wetter die Mitbewohner kaum sprach, wußte sie nicht zu sagen, ob jemand gegen sie beide Neid im Herzen hegte. Hochsteigen war noch niemandem leicht gemacht worden; wer ausgezeichnet wurde, dem war Mißgunst sicher, und so etwas drückte sich ja immer und zuerst bei Kauf und Verkauf aus. Dabei bügelte sie fleißig kleine Wäsche, die sie am Tage durchgeseift, und zeigte nicht, weder im Gesicht noch mittels der Stimme,ob sie von dieser Veränderung innerlich berührt oder gar schon geängstigt wurde. Albert jedenfalls lachte über die Dummheit der Wandsbeker an jenem Abend, setzte eine forsche Miene auf und versprach ihr und sich, auf Abwehr zu sinnen, sich den blöden Kram keineswegs gefallen zu lassen.
Im Verlauf der nächsten Wochen wurde er wütend. Was war denn das für eine Wirtschaft, die den Leuten auf der einen Seite Angst machte, es könnte wegen Österreich zum Kriege kommen, und auf der anderen Seite gegen die sinkende Kraft und Lust zum Kaufen kein Mittel und keinen Ausweg wußte! Wenn aber die Kollegen keine wesentliche Veränderung merkten – wie war es dann zu erklären, daß sich bei ihm keine Katze mehr über die Schwelle bemühte? Lehmkes waren schweigsam und meinten, es liege am Wetter. Stine dagegen kam eines Abends mit einem anderen Buch vom Dach und hatte des Rätsels Lösung mit. Die Ratten in den Fleeten hätten sich vermehrt, hieße es, und das lenke die Aufmerksamkeit auf mangelhafte Gesundheitszustände in vielen Betrieben, die Nahrungsmittel lieferten. Es ginge Gerede um, in manchen Schlächtereien sei es mit der Hygiene nicht zum besten bestellt. Vielleicht verbreitete irgendwer auch über sie, Teetjens, solche Gerüchte – aus Neid, aus Freude am Tratsch, aus Wichtigtuerei. Wahrscheinlich mußte man wieder einmal eine Anzeige dichten, in der die Worte »blitz und blank« vorkamen, zum Beispiel: »Keinen Schatten von Ratten, blitz und blank, auf Tisch und Bank. Aber es kostete wieder eine Extraausgabe. Albert meinte, die könne man nicht umgehen. Ob die Leute
Weitere Kostenlose Bücher