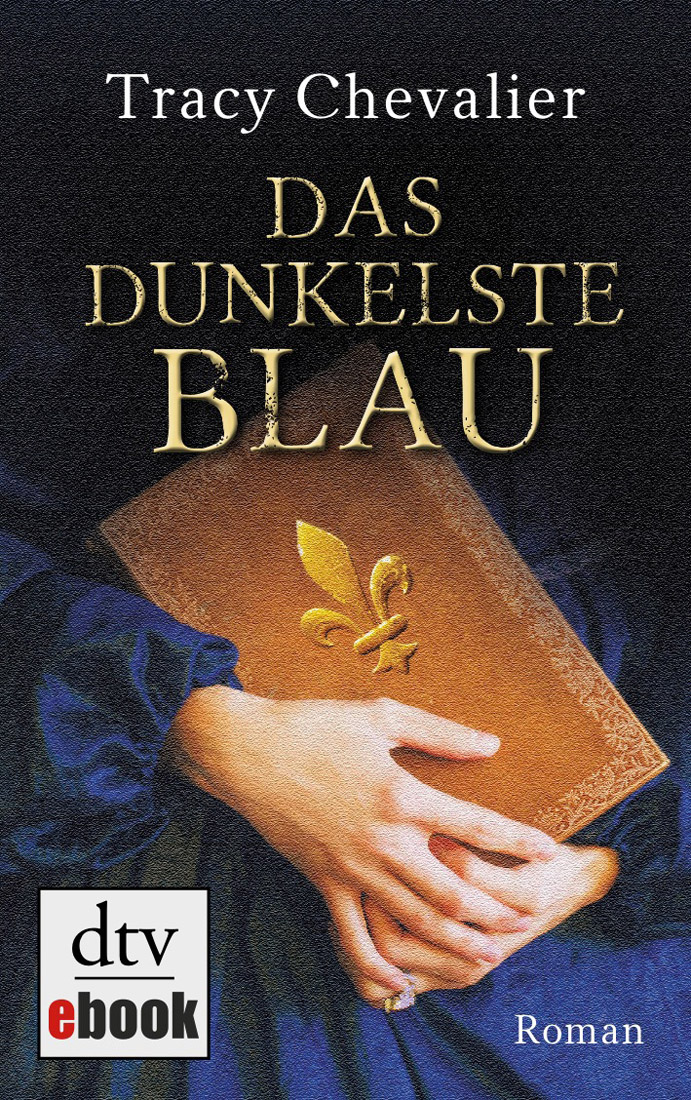![Das dunkelste Blau]()
Das dunkelste Blau
hinter dem Tresen, als ich die Bibliothek zum zweiten Mal aufsuchte; statt dessen stand ein Mann dort, der gerade telefonierte; seine scharfen braunen Augen konzentrierten sich auf einen Punkt draußen auf dem Marktplatz; auf seinem kantigen Gesicht lag ein sardonisches Lächeln. Er war ungefähr so groß wie ich, trug schwarze Hosen und ein weißes Hemd ohne Krawatte, das am Kragen zugeknöpft war, und hatte die Ärmel über die Ellbogen hochgerollt. Ich plazierte ihn in der Kategorie des einsamen Wolfes. Lächelnd dachte ich: Das ist einer, den ich meiden sollte.
Ich wandte mich von ihm ab und steuerte auf die englischsprachige Abteilung zu. Sie sah aus, als ob ein paar Touristen einen Sack voller Urlaubslektüre gespendet hätten: Lauter Thriller und Liebesromane. Es gab außerdem eine gute Auswahl von Agatha-Christie-Krimis. Ich fand einen, den ich noch nicht kannte, und stöberte dann in der Abteilung mit französischer Literatur. Madame Sentier hatte Françoise Sagan als relativ schmerzlose Anfangslektüre für mein Französisch empfohlen; ich wählte ›Bonjour Tristesse‹. Als ich mich auf den Weg zum Tresen machte, warf ich einen Blick auf den Wolf dahinter, dann auf meine beiden frivolen Bücher und hielt inne. Ich ging zurück zur englischsprachigen Abteilung und nahm ›The Portrait of a Lady‹ noch dazu.
Ich brütete noch eine Weile über einer Ausgabe von ›Paris-Match‹. Schließlich brachte ich meine Bücher zum Schalter. Der Mann musterte mich ausgiebig, und als er die Bücher sah, zählte er zwei und zwei zusammen. Mit einem kaum sichtbaren Grinsen im Mundwinkel sagte er auf englisch: »Ihre Karte?«
Du Idiot, dachte ich. Ich haßte diesen herablassenden Spott, dieses Vorurteil, daß ich kein Französisch sprach, weil ich so amerikanisch aussah.
»Ich würde mich gerne für eine Karte anmelden«, erwiderte ich in sorgfältigem Französisch, bemüht, die Worte ohne die Spur eines amerikanischen Akzentes auszusprechen.
Er gab mir ein Formular. »Füllen Sie das aus«, befahl er auf englisch.
Ich ärgerte mich so sehr, daß ich, als ich die Anmeldung ausfüllte, meinen Nachnamen als Tournier statt als Turner aufschrieb. Trotzig schob ich ihm das Formular zusammen mit Führerschein, Kreditkarte und einem Brief von der Bank mit unserer Adresse darauf hin. Er sah kurz auf die Ausweisdokumente, runzelte dann die Stirn, als er das Formular sah.
»Was soll das ›Tournier‹?« fragte er, mit dem Finger auf meinen Namen tippend. »Es ist Turner, nicht? Wie Tina Turner?«
Ich antwortete weiterhin auf französisch. »Ja, aber mein Familienname war ursprünglich Tournier. Er wurde von meiner Familie geändert, als sie in die USA kam. Im neunzehnten Jahrhundert. Sie nahmen das ›o‹ und das ›i‹ heraus, damit er amerikanischer würde.« Das war das winzige bißchen Familiengeschichte, das ich kannte, und ich war stolz darauf, aber leider war klar, daß er davon überhaupt nicht beeindruckt war. »Viele Familien änderten ihre Namen, als sie auswanderten –« Ich brach ab und wich seinem spöttischen Blick aus.
»Ihr Name ist Turner, also muß Turner auf die Karte, nicht?«
Ich fiel ins Englische. »Ich – weil ich jetzt hier lebe, dachte ich, ich könnte anfangen, Tournier zu benutzen.«
»Aber Sie haben keinen Ausweis oder Brief mit Tournier drauf, nein?«
Ich schüttelte den Kopf und blickte finster auf den Stapel Bücher, die Ellbogen in meine Seiten gepreßt. Zu meiner größten Demütigung füllten meine Augen sich mit Tränen. »Macht nichts, es ist nicht wichtig«, murmelte ich. Ich sah ihn nicht an, als ich meine Ausweise an mich nahm, mich umdrehte und hinausstolperte.
Am gleichen Abend öffnete ich die Haustür, um zwei streitendeKatzen wegzuscheuchen, als ich auf der obersten Treppenstufe über einen Stapel Bücher stolperte. Die Bibliothekskarte lag obenauf und war auf den Namen Ella Tournier ausgestellt.
Ich mied die Bibliothek und unterdrückte den Impuls, extra hinzugehen, um mich bei dem Bibliothekar zu bedanken. Noch hatte ich nicht gelernt, wie man sich bei den Franzosen bedankt. Immer, wenn ich etwas kaufte, schien es mir, als bedankten sie sich während der Transaktion viel zu häufig; gleichzeitig bezweifelte ich ihre Aufrichtigkeit. Es war schwer, den Tonfall zu deuten. Aber der Sarkasmus des Bibliothekars war deutlich gewesen; ich konnte mir nicht vorstellen, daß er meinen Dank freundlich entgegennehmen würde.
Ein paar Tage, nachdem die Bibliothekskarte
Weitere Kostenlose Bücher