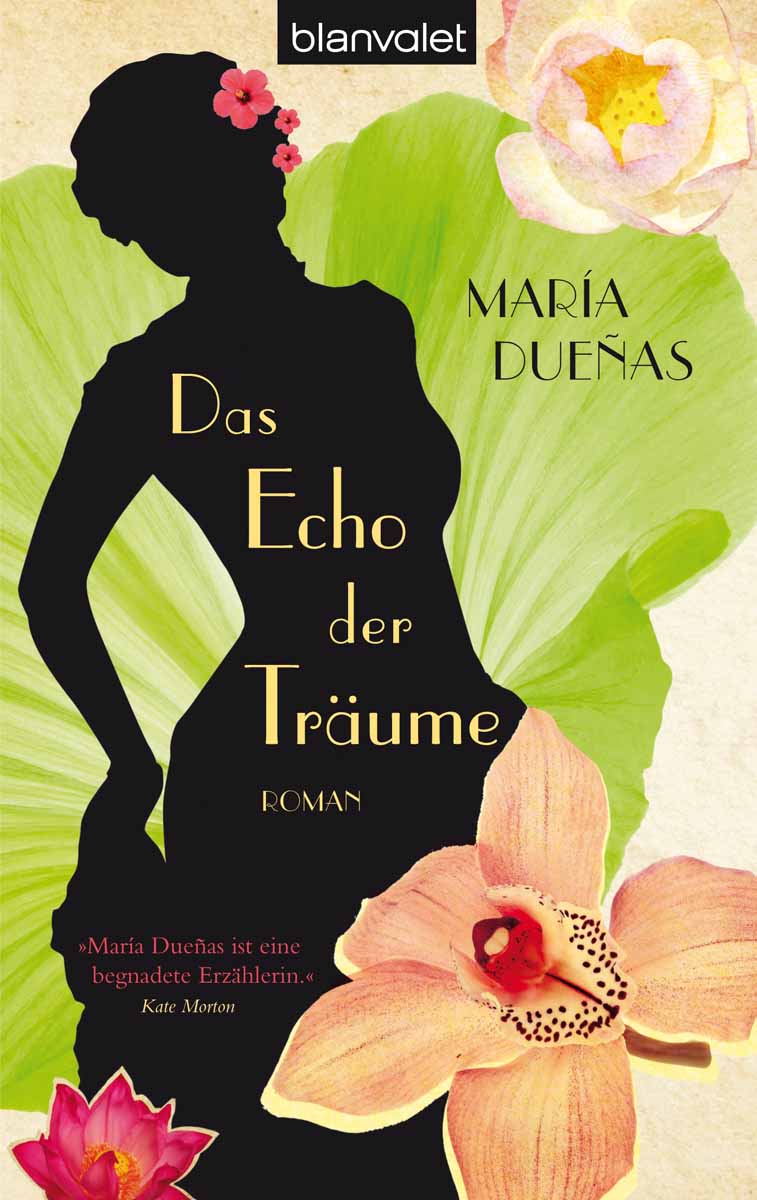![Das Echo der Traeume]()
Das Echo der Traeume
Kinogänger, die eigentlich nach draußen wollten, mischten sich mit denen, die schon zur nächsten Vorstellung gekommen waren, die gleich beginnen sollte. Ich stellte mich etwas entfernt von der Masse hinter eine Säule, wo ich mich in all dem Lärm und dem Rauch aus tausend Zigaretten anonym und vorerst sicher fühlte. Doch dieses Gefühl war nur von kurzer Dauer, bis nämlich die Menschenmasse sich aufzulösen begann. Den gerade Gekommenen wurden endlich die Türen zum Kinosaal geöffnet, damit sie sich dem Unglück der de Winters und ihren Geistern hingeben konnten. Die anderen Besucher – die Vorausschauenden unter dem Schutz von Regenschirmen und Hüten, die Unbedachten mit hochgezogenen Jacken und auseinandergefalteten Zeitungen über dem Kopf, oder die Unerschrockenen, die der Witterung einfach trotzten –, sie alle verließen nach und nach die fantastische Welt des Kinos und traten hinaus auf die Straße, um sich der banalen Realität zu stellen, einer Realität, die sich an diesem Herbstabend hinter einem dichten Wasservorhang präsentierte, der unerbittlich vom Himmel fiel.
Ein Taxi zu bekommen war von vornherein aussichtslos, sodass ich mich, wie Hunderte von Kinobesuchern vor mir, innerlich wappnete und mit einem seidenen Taschentuch auf dem Kopf und hochgeschlagenem Mantelkragen im strömenden Regen auf den Heimweg machte. Ich eilte die Straßen entlang, denn ich wollte möglichst schnell nach Hause und ins Trockene, aber auch meinen Ängsten entkommen, die mich auf Schritt und Tritt verfolgten. Ständig wandte ich den Kopf: Mal glaubte ich mich verfolgt, mal meinte ich, der Verfolger hätte aufgegeben. Jeder Mann mit einem Trenchcoat ließ mich noch schneller ausschreiten, auch wenn seine Gestalt gar nicht der jenes Mannes entsprach, den ich fürchtete. Als jemand zügig an mir vorbeiging und mich dabei unabsichtlich am Arm berührte, flüchtete ich mich vor das Schaufenster einer geschlossenen Apotheke. Ein Bettler, der mich am Ärmel zog und um eine milde Gabe bat, erhielt von mir nicht mehr als einen leisen Schreckensschrei als Almosen. Eine Weile hielt ich Schritt mit verschiedenen Paaren, bis sie selbst, irritiert durch meine aufdringliche Nähe, schneller gingen, um mich loszuwerden. Meine Strümpfe wiesen durch die vielen Pfützen bereits zahlreiche Schmutzspritzer auf, und zu allem Überfluss blieb ich mit dem Absatz meines linken Schuhs in einem Gullydeckel hängen. Hastig und ängstlich überquerte ich die Straßen, auf den Verkehr achtete ich kaum. Auf einer Kreuzung blendeten mich die Scheinwerfer eines Automobils, ein Stück weiter hupte mich ein dreirädriger Lieferwagen wütend an, und fast hätte mich eine Straßenbahn überfahren. Ein paar Meter weiter konnte ich mich nur durch einen Sprung vor dem Zusammenprall mit einem dunklen Wagen retten, der mich bei dem starken Regen wohl nicht gesehen hatte. Oder vielleicht doch.
Nass bis auf die Haut und völlig außer Atem kam ich schließlich vor meiner Haustür an. Ein paar Meter weiter standen der Hausmeister, der Nachtwächter, ein paar Nachbarn und fünf oder sechs Schaulustige zusammen, um die Schäden zu begutachten, die durch das in den Kellern zusammengelaufene Wasser entstanden waren. Ich lief die Treppe hinauf, nahm zwei Stufen auf einmal, ohne dass mich jemand bemerkt hätte, und zog das durchnässte Seidentuch vom Kopf, während ich nach den Schlüsseln kramte. Ich war erleichtert, dass ich es bis nach Hause geschafft hatte, ohne meinem Verfolger zu begegnen, und wollte nur noch ein heißes Bad nehmen, um die Kälte und Angst in mir loszuwerden. Doch die Erleichterung währte nicht lange, nämlich nur die wenigen Sekunden, die ich brauchte, um meine Wohnungstür aufzuschließen, einzutreten und festzustellen, dass etwas nicht stimmte.
Dass im Salon eine Lampe brannte, obwohl die ganze Wohnung im Dunkeln liegen sollte, war zwar nicht normal, doch es konnte eine Erklärung dafür geben. Doña Manuela und die beiden Mädchen schalteten zwar alle Lichter aus, ehe sie gingen, hatten an diesem Abend aber vielleicht vergessen, einen letzten Rundgang zu machen. Deshalb war es nicht das Licht der Lampe, das mich irritierte, sondern was ich an der Garderobe am Eingang vorfand. Einen Trenchcoat. Hell, Männergröße. Er hing auf einem Kleiderbügel und tropfte – Unheil verkündend – vor sich hin.
43
Der Besitzer des Trenchcoats erwartete mich im Salon. Eine ganze Weile, die mir wie eine Ewigkeit erschien, stand ich stumm da. Auch
Weitere Kostenlose Bücher