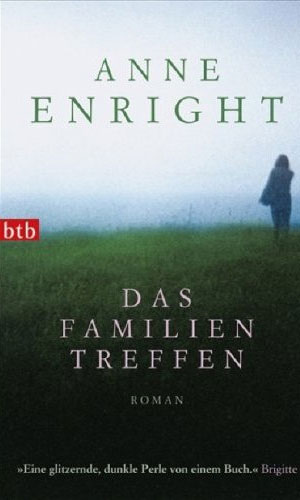![Das Familientreffen]()
Das Familientreffen
1
Ich möchte niederschreiben, was im Haus meiner Großmutter geschah in dem Sommer, als ich acht oder neun war. Aber ob es wirklich geschehen ist? Mit Gewissheit kann ich es nicht sagen. Ich muss von etwas Ungewissem Zeugnis ablegen und spüre, wie es in mir tobt – dieses Etwas, das sich vielleicht gar nicht zugetragen hat. Ich weiß nicht einmal, wie ich es benennen soll. Man könnte es ein Verbrechen des Fleisches bezeichnen, aber das Fleisch ist längst abgefallen, und vielleicht lebt der Schmerz ja in den Knochen fort.
Mein Bruder Liam hat Vögel geliebt, und wie alle Jungen liebte er die Knochen toter Tiere. Ich habe keine Söhne, und deshalb halte ich kurz inne, wenn ich auf einen schmalen Schädel stoße oder auf ein kleines Skelett, und denke an ihn, daran, wie er ihren feinen Knochenbau bewunderte, die alten Arme einer Elster, die aus dem struppigen Federkleid ragten; kurz und hell und sauber. Das ist das Wort, das wir für Knochen benutzen: sauber.
Meinen Töchtern sage ich natürlich, sie sollen sich fernhalten von dem Mäuseschädel im Wald oder von dem toten Finken, der an der Gartenmauer verwest. Ich weiß nicht einmal, warum. Obwohl – manchmal finden wir am Strand eine Sepiaschale, die so rein ist, dass ich sie einfach in die Tasche stecken muss, und meine Hand findet Trost in der Geborgenheit ihrer weißen Krümmung.
Man kann die Toten nicht verunglimpfen, glaube ich, man kann sie nur trösten.
Deshalb bringe ich Liam dieses Bild dar: meine beiden Töchter, wie sie unter einem aufgewühlten, sich nur langsam verändernden Himmel am sandigen Rand eines steinigen Strandes entlangrennen und wie ihnen dabei die Mäntel von den Schultern gleiten. Dann blende ich das Bild aus, schließe die Augen und wiege mich im lauten Tosen des Meeres. Wenn ich sie wieder öffne, dann, um die Mädchen zum Wagen zurückzurufen.
Rebecca! Emily!
Es ändert nichts daran. Ich kenne die Wahrheit nicht – oder kann ich sie einfach nur nicht in Worte fassen? Alles, was ich habe, sind Geschichten, Nachtgedanken, die plötzlichen Gewissheiten, die die Unsicherheit hervortreibt. Alles, was ich habe, sind eigentlich eher Delirien. Sie hat ihn geliebt! , sage ich. Sie muss ihn geliebt haben! Ich warte auf die Art von Vernunft, die mit dem Morgengrauen kommt, wenn man nicht geschlafen hat. Während die Familie über mir atmet, bleibe ich unten im Haus und schreibe alles nieder, arrangiere sie in hübschen Sätzen, meine sauberen weißen Knochen.
2
Es gibt Tage, an denen ich mich an meine Mutter nicht erinnern kann. Ich betrachte ihr Foto, und sie entgleitet mir. Oder ich besuche sie an einem Sonntag, nach dem Mittagessen, wir verbringen einen angenehmen Nachmittag, und wenn ich gehe, wird mir bewusst, dass sie wie Wasser durch mich hindurchgeflossen ist.
»Auf Wiedersehen«, sagt sie und verblasst bereits. »Auf Wiedersehen, mein Mädchen«, und sie hebt mir ihr weiches altes Gesicht zum Kuss entgegen. Das bringt mich heute noch in Rage. Die Art, wie sie sich verflüchtigt, sobald ich mich umdrehe, und wenn ich wieder hinschaue, sehe ich nur noch einen Schemen. Ich glaube, sollte sie sich jemals einen anderen Mantel kaufen, würde ich auf der Straße an ihr vorübergehen. Würde meine Mutter ein Verbrechen verüben, gäbe es keine Zeugen – sie würde gar nicht wahrgenommen werden.
»Wo ist mein Portemonnaie?«, fragte sie immer, als wir noch Kinder waren – es mochten auch ihre Schlüssel sein oder ihre Brille. »Hat jemand mein Portemonnaie gesehen?« Und wenn sie dann von der Diele ins Wohnzimmer, in die Küche und wieder zurück lief, war sie für jene wenigen Sekunden beinahe greifbar. Schon damals blickten wir überallhin, nur nicht zu ihr: Sie war die Unruhe in uns, eine Art kollektiver Schuld, wenn wir uns im Raum umschauten, wohl wissend, dass unsere Augen über das dicke braune Portemonnaie hinweghuschen würden, selbst wenn es ganz deutlich zu sehen war.
Dann fand Bea es. Immer ist ein Kind da, das nicht nur sehen, sondern auch wahrnehmen kann. Das stille Kind.
»Danke, Schatz.«
Um gerecht zu sein, meine Mutter ist eine so konturlose Person, dass sie sich möglicherweise nicht einmal selbst wahrnimmt. Möglicherweise fährt sie mit der Fingerspitze über eine Reihe Mädchen auf einem alten Foto und kann sich und die anderen nicht auseinanderhalten. Und von allen ihren Kindern bin ich diejenige, die am stärksten ihrer eigenen Mutter ähnelt, meiner Großmutter Ada. Das muss verwirrend
Weitere Kostenlose Bücher