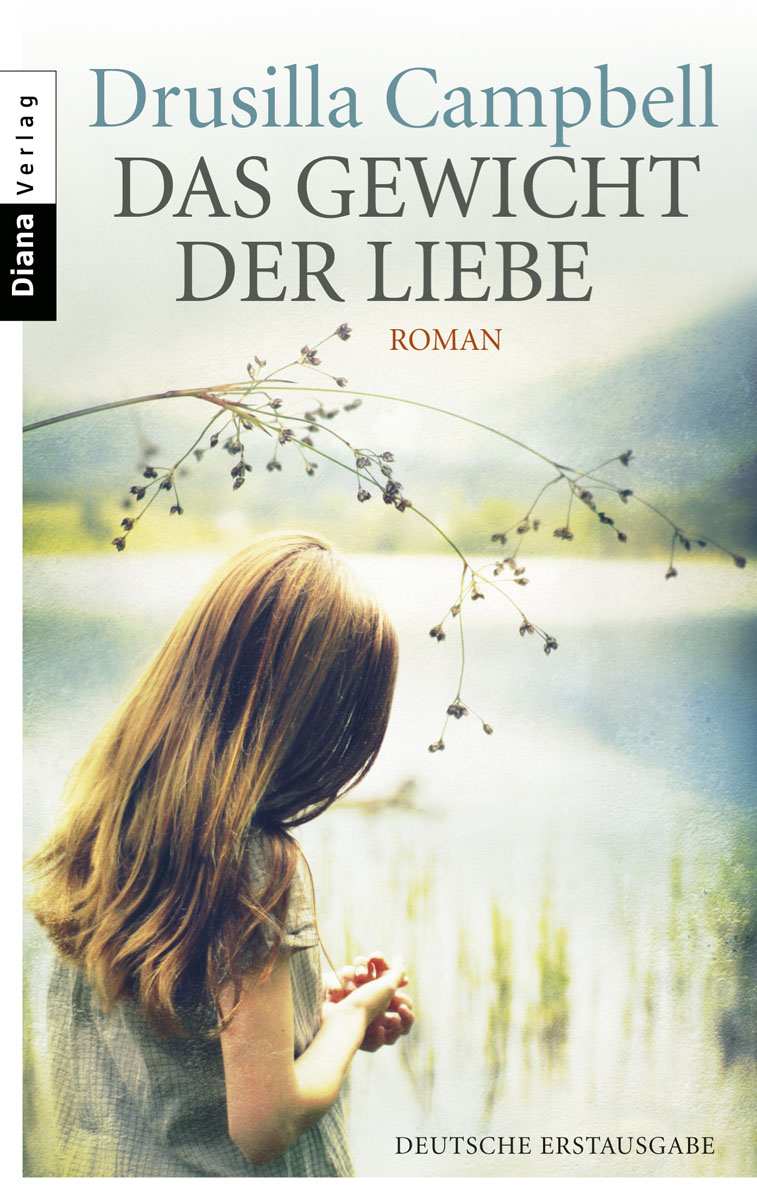![Das Gewicht der Liebe]()
Das Gewicht der Liebe
ebenfalls bewusst. Ich sehe noch den Blick vor mir, den er mir beim Frühstück über die Müslipackungen hinweg zuwarf, wenn zwischen unserer Mutter und unserem Vater mal wieder eine so dicke Luft herrschte, dass wir kaum noch atmen konnten.
Eine postpartale Depression betrifft die ganze Familie.
Damals wie jetzt ließ sich unsere Mutter mit Adjektiven wie anpassungsfähig , begeisterungsfähig , neugierig und verspielt beschreiben. Sicher, sie hatte ihre Stimmungen. Mom erzählte mir, sie seien unvermeidlich. »Die Melancholie liegt uns Iren im Blut, man kann nichts dagegen tun«, sagte sie. »Nichts geht über ein gutes Flennen.« Sie weinte, weil mein Vater so war, wie er war, und nicht der Mann, der zu sein sie geträumt hatte, weil Pläne misslangen und Hunde starben, und weil sie durch Tausende von ozeani schen Meilen von ihren Eltern und allen anderen Verwand ten, bis auf eine ihrer Schwestern, getrennt war. Sie liebte die alten Victorianischen Weisen, die sie mit ihren Schwestern im Kreis um das Klavier herum gesungen hatte, die sentimentalen Balladen von Vertreibung und frühem Tod. Als ich klein war, bat ich sie oft, »Lilac Tree« mit mir zu singen, und am Schluss waren wir beide immer in Tränen aufgelöst. Es war etwas Familienspezifisches.
Trotz dieser Tränenfluten erinnere ich mich an meine junge Mutter als eine heitere und vor allem unverwüstliche Frau, was sie in unserer Familie auch sein musste, wo man oft klamm (einer ihrer Ausdrücke für Geldknappheit) war, immer kämpfen musste. An den meisten Tagen meiner Kindheit erwachte ich morgens zum Klang ihrer hübschen Sopranstimme, die vom Fuß der Treppe zu mir hinauftönte: Patrick, Michael, Seamus O’Brien could never stop sighin’ for sweet Molly O / Every morning, up like a sparrow and out like an arrow just leavin’ the bow .
Das Singen hörte auf, als Margaret Ellen zur Welt kam und ein düsterer Schatten sich über unser Heim legte. Ich entsinne mich, wie ich nach der Schule die Haustür mit einer gespannten Wachsamkeit öffnete, die für mich völlig neu war, einer Unsicherheit über das, was mich auf der anderen Seite der Tür erwartete. Meistens verlangsamte sich alles, wenn meine energiegeladene Mutter von einer auszehrenden Antriebslosigkeit überwältigt wurde, die sie für mich zu einem anderen Menschen machte. Meinem Vater – nie einer, der die Nuancen menschlichen Verhaltens mitbekam – war das alles zu hoch, zu dubios. Ich bin mir sicher, dass er nie die Hilfe eines Arztes oder Priesters beansprucht hat. Sich einen Rat für ein so privates und peinliches Problem wie den Nervenzusammenbruch – das Uni versalschlagwort für jegliche emotionale Störung – der eigenen Ehefrau einzuholen, war in unserer Familie mit einem Bann belegt. In jener Zeit behielt man – nicht nur wir, sondern auch die meisten anderen Leute – seine persönlichen Probleme für sich.
Es war die Zeit des Kalten Kriegs, und nach Margaret Ellens Geburt wurde meine Mutter besessen von der Angst vor einer drohenden nuklearen Katastrophe. Sie schrieb einen Brief an den Präsidenten, was sich heutzutage nach nichts Besonderem anhört, aber damals eine große Sache war, eine Kühnheit geradezu. Aus Respekt musste der Brief getippt sein, was bedeutete, dass unsere altertümliche Schreibmaschine von ihrem Platz unter der Treppe her vorgeholt, das Farbband ersetzt (eine schmutzige, müh same Arbeit) und das nötige Kleingeld zusammengekratzt werden musste, um das richtige Papier zu kaufen, weil man einen Brief an den Präsidenten nicht auf irgendein schäbiges Blatt Papier schreiben konnte. Und danach muss te man die richtigen Worte finden und tippen, das Papier aus der Maschine reißen, alles noch einmal tippen und noch einmal, bis der Brief endlich perfekt war.
Meine letzte Erinnerung an die postpartale Depression meiner Mutter ist das Bild, wie ich, nach einer abendlichen Schulveranstaltung in meinem Bett im oberen Stockwerk liegend, den Gesprächsfetzen eines Streits lauschte, die von unten heraufdrangen: Mom weinte, bat darum, angehört zu werden, verstanden zu werden, und Dad versuchte das aufrichtig, doch es gelang ihm nicht. Ich stand wieder auf und öffnete meine Zimmertür. Auf der anderen Seite des Treppenabsatzes stand Kip, wie ich im Schlafanzug und barfuß, in seiner Tür und hatte diesen besorgten Ausdruck im Gesicht. Wortlos schlichen wir die Treppen hinunter und setzten uns nebeneinander auf eine Stufe. Ich entsinne mich, dass ich zum ersten
Weitere Kostenlose Bücher