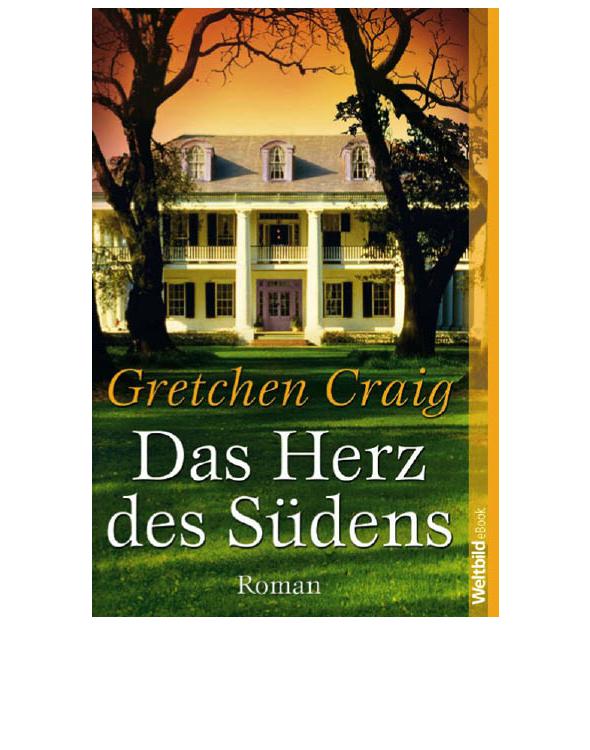![Das Herz des Südens]()
Das Herz des Südens
Fieber. Cleo wird bestimmt wieder gesund, das glaube ich sicher.« Er sah, wie sie zwei-, dreimal blinzelte, um die Angst zu vertreiben. »Du musst Gabriel solange zu dir nehmen.«
»Gern, Phanor.« Sie streckte die Hand nach Gabriel aus, hoffte, er würde sich nicht vor ihr zurückziehen. Aber er griff nur nach einem ihrer Finger und steckte ihn sich in den Mund.
»Glaubst du, er hat Hunger?«, fragte Phanor.
»Wenn es so ist, ist er hier jedenfalls am richtigen Ort«, gab Josie zurück. Sie langte über den Tisch nach einer kleinen Pfirsichpastete und gab sie Gabriel, der sofort an der harten Kruste zu kauen begann und die Erwachsenen vergaß. Als Phanor ihn Josie herüberreichte, akzeptierte er den Platzwechsel, ohne seine Aufmerksamkeit von dem Kuchen abzuwenden.
»Ich suche jetzt einen Arzt«, sagte Phanor. »In ein paar Tagen, wenn es Cleo besser geht, komme ich wieder.«
»Wo ist sie? Ich meine, wo lebt sie?«
»In der Rue Noisette, am anderen Ende der Rue Dauphine. Das grüne Häuschen mit dem Aprikosenbaum davor.« Er zögerte. »Aber du brauchst nicht zu kommen. Ich bin bei ihr, und mir ist schon sehr geholfen, wenn du dich um Gabriel kümmerst.«
Er trat hinaus ins gleißend helle Licht der Straße und bereute sofort wieder, dass er seinen Hut vergessen hatte. »Ich komme bald wieder, mach dir keine Sorgen«, sagte er und stieg aufs Pferd.
Eilig ritt er durch die stillen Straßen, über denen die heiße Luft bewegungslos und schweigend brütete. Der Rauch von kleinen Feuern aus Knochen, Häuten, Horn und Hufen – was immer die Menschen sich erdachten, um die Infektionsgefahr zu bannen – hing über seinem Kopf.
Beim Krankenhaus fand er einen Schatten spendenden Baum für sein Pferd und ging zur offenen Pforte. Beim Anblick der vielen Toten, die in Reihen ausgelegt im Hof aufs Einwickeln warteten, schauderte er.
Dicke schwarze Fliegen summten über den Toten, und in einer Ecke entdeckte Phanor das flüchtige Huschen von Ratten.
Schnell wandte er den Blick ab und ging durch die Reihen der Toten zur hinteren Veranda des Krankenhauses.
Die unbewegliche Stille im Hof hatte ihn nicht auf den Lärm und das Chaos vorbereitet, das drinnen herrschte. Männer und Frauen lagen auf allen Betten und Pritschen, selbst auf dem nackten Fußboden. Schüsseln mit Blut und ekelerregenden Flüssigkeiten standen hier und dort herum, wimmelnd vor Fliegen. Phanor hielt sich mit einer Hand die Nase zu und ließ seinen Augen ein bisschen Zeit, sich an das Halbdunkel zu gewöhnen.
Drei Krankenschwestern bewegten sich langsam durch die Reihen der Fieberopfer, zu müde und erschöpft, um sich noch zu beeilen. Am anderen Ende des Saales versuchte eine Schwester, einen Mann zu beruhigen, der einen Tobsuchtsanfall hatte. Auf einem Bett nahe bei Phanor schrie eine junge Frau im Delirium laut auf und schlug mit beiden Armen um sich. Ihre Augen waren gelblich verfärbt und glänzten; sie schienen förmlich aus ihren Höhlen zu quellen. Phanor musste den Blick abwenden.
Er ging auf die Krankenschwester zu, die ihm am nächsten war, eine Weiße, die gerade ein nach vorn gebeugtes Kind mit einem in Essigwasser getränktem Schwamm abrieb. Sie sah zu ihm auf, ein Gesicht, gezeichnet von Schlafmangel und der Allgegenwart des Todes.
»Ich brauche einen Arzt«, begann Phanor.
Die Schwester starrte ihn an. »Sie brauchen doch keinen Arzt!«
»Doch, eine Freundin von mir hat das Fieber, und sie braucht einen Arzt.«
»Damit er ihr ein bisschen Blut aus dem Arm abzapfen kann? Oder sie schröpfen?«
»Ich weiß nicht, was er tun würde. Ich weiß nur, sie ist krank und braucht einen Arzt.«
»Sehen Sie, Monsieur, tun Sie einfach für die arme Seele, was ich hier tue. Halten Sie sie sauber, waschen Sie sie regelmäßig kalt ab, um ihren Körper zu kühlen, geben Sie ihr so viel Wasser zu trinken wie möglich – und beten Sie.«
Phanor sah sich in dem großen, offenen Saal um. Es gab keinen einzigen Arzt in diesem Krankenhaus. Die wenigen Männer, die hier aufrecht umhergingen, waren die zwei Helfer, die die Toten in den Hof hinaustrugen. Die drei Frauen schufteten allein, um diese Dutzende von Opfern zu versorgen.
»Wo sind die Ärzte?«, fragte er.
»Bei den reichen Patienten, wo denn sonst. Wobei die auch keine höhere Überlebenschance haben als dieses Kind hier. Ich habe Ihre feinen Ärzte gesehen, wie sie Patienten so lange zur Ader ließen, bis sie kaum noch Blut in sich hatten und starben. Sie brauchen keinen Arzt.« Sie
Weitere Kostenlose Bücher