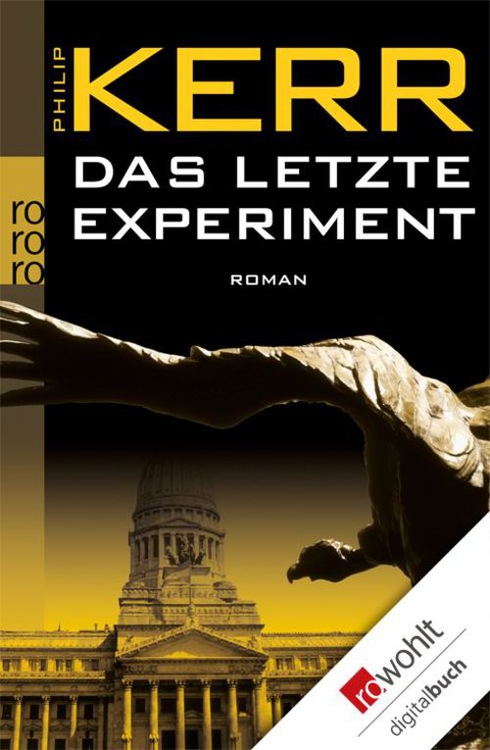![Das letzte Experiment]()
Das letzte Experiment
Gebüsch mit ihren Freiern trieben. Die Natur ist wunderbar.
Als ich das Brandenburger Tor durchquerte und den Pariser Platz erreichte, warf ich einen Blick auf meine Uhr. Es war Zeit für einen Mittagsimbiss – einen Imbiss in einer braunen Flasche. Ich hätte mehr oder weniger überall südlich von Unter den Linden halten können. Es gab nahezu beliebig viele Stehimbisse rings um den Gendarmenmarkt herum, wo ich mir ein Würstchen und ein Bier hätte kaufen können, doch beliebig war nicht das, was ich wollte. Nicht, wenn ich in unmittelbarer Nähe des Hotels Adlon war. Zugegeben, ich war erst ein oder zwei Tage vorher dort gewesen, und ein oder zwei Tage davor ebenfalls. Tatsache war, ich mochte das Adlon. Nicht wegen seines Ambientes, seines Gartens und seines Palmenhofs, seines flüsternd plätschernden Springbrunnens und seines fabelhaften Restaurants, das ich mir außerdem gar nicht leisten konnte. Ich mochte das Adlon, weil ich einen Hausdetektiv dort mochte. Eine Detektivin, genau genommen. Sie hieß Frieda Bamberger, und ich mochte Frieda sehr.
Frieda war groß und dunkelhaarig, ihre Lippen waren voll, undihr Körper war üppig. Sie war Jüdin, und außerdem sehr glamourös. Sie musste es sein. Ihre Aufgabe war es, sich im Hotel herumzutreiben, getarnt als Gast, und die Augen nach Prostituierten, Betrügern und Dieben offenzuhalten, die sich von den reichen Gästen eine fette Beute erhofften.
Ich hatte Frieda im Sommer 1929 kennengelernt, als ich ihr geholfen hatte, eine mit einem Messer bewaffnete Juwelendiebin zu verhaften. Ich hatte verhindert, dass die Diebin sich mit dem Messer auf Frieda stürzte, indem ich mich ihr in den Weg gestellt hatte und selbst etwas abbekam. Sehr geschickt, Gunther. Für meine «Heldentat» bekam ich einen netten Brief von Hedda Adlon, der Schwiegertochter des Besitzers, und nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein sehr persönliches Dankeschön von Frieda. Wir hatten nicht viel gemeinsam. Frieda hatte einen Ehemann, der in Hamburg wohnte. Doch hin und wieder durchsuchten wir ein leeres Zimmer nach einem verschwundenen Maharadscha oder einem gestohlenen Filmsternchen, und manchmal benötigten wir eine ganze Weile dafür.
Sobald ich die Lobby betrat, hakte Frieda sich bei mir unter. «Ich bin ja so froh, dich zu sehen!», sagte sie.
«Und ich dachte immer, du machst dir nichts aus mir.»
«Ich meine es ernst, Bernie.»
«Ich auch. Ich hätte Blumen mitgebracht, wenn ich gewusst hätte, wie du empfindest.»
«Ich möchte, dass du in die Bar gehst», sagte sie drängend.
«Das ist gut. Da wollte ich sowieso hin.»
«Ich möchte, dass du dir den Kerl dort in der Ecke ansiehst. Und ich meine den Freier, nicht die Rothaarige daneben, hörst du? Er trägt einen taubengrauen Dreiteiler mit einer doppelreihigen Weste und einer Blume im Revers. Er gefällt mir nicht.»
«Wenn das so ist, dann hasse ich ihn schon jetzt.»
«Nein, ich denke, er ist vielleicht gefährlich.»
Ich ging in die Bar, nahm mir ein Streichholzbriefchen und zündetemir eine Zigarette an, während ich den Mann unauffällig von oben bis unten musterte. Die Rothaarige musterte mich von oben bis unten, allerdings nicht besonders unauffällig. Das war nicht gut, denn der Kerl war gefährlicher als gefährlich. Er war Ricci Kamm, der Boss der Allzeit Getreuen, Berlins mächtigster Bande. Normalerweise verließ Ricci Friedrichshain nicht, wo seine Bande ihre Basis hatte. Mir war das recht, weil er uns dort in der Regel keine Scherereien machte. Doch die Rothaarige sah aus, als hätte sie eine Meinung von sich, die mindestens so hoch war wie die Zugspitze. Wahrscheinlich dachte sie, dass sie zu gut war für Läden wie die Kneipe Zum Nussbaum, wo die Allzeit Getreuen normalerweise verkehrten. Sehr wahrscheinlich hatte sie sogar recht damit. Ich hatte zwar schon einen hübscheren Rotschopf gesehen, das Exemplar hier hatte jedenfalls verdammt aufregende Kurven.
Ricci starrte mich an, und ich starrte sie an, und vor den beiden stand eine Flasche Bismarck, weshalb ich wahrscheinlich gleich Schwierigkeiten bekommen würde. Ricci gehörte zu der stillen Sorte. Er sprach leise und freundlich und hatte gute Manieren – bis er einen Drink zu viel intus hatte. Ab da konnte man förmlich zusehen, wie sich Dr. Jekyll in Mr. Hyde verwandelte. Dem Flascheninhalt nach zu urteilen, würde dieser Verwandlungsprozess jeden Moment beginnen.
Ich machte auf dem Absatz kehrt und marschierte in die Lobby
Weitere Kostenlose Bücher