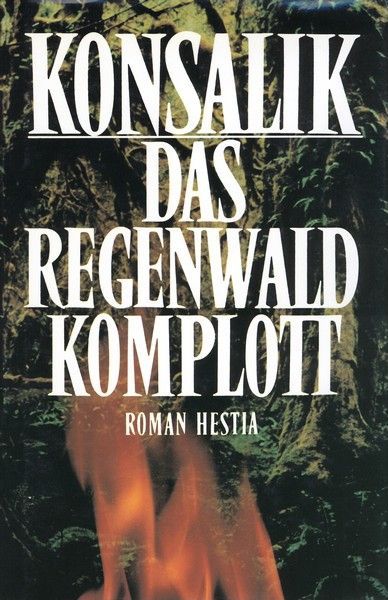![Das Regenwaldkomplott]()
Das Regenwaldkomplott
haben. Nein, wir bleiben hier. Für diese Arbeit habe ich meine Spezialisten. Assis wird in unserem Namen einen Kranz niederlegen.«
Von Novo Lapuna kam eine große Delegation nach Santo Antônio. Nicht nur die Ärzte der Goldgräberstadt wollten dem schon legendären Kollegen die letzte Ehre erweisen, auch Bento, Helena, Leonor und sogar der Mafioso Emilio Carmona, der Thomas nie kennengelernt hatte und das zutiefst bedauerte, waren mit einer langen Wagenkolonne gekommen. Mindestens hundert Garimpeiros standen auf dem weiten Platz vor der Mission herum und bestaunten die vornehmen Herren und Damen, die aus den Flugzeugen kletterten.
»Das sind die Geldsäcke, für die wir in der Mine schuften!« sagte einer aus der zusammengedrängten Menge. »Seht sie euch an. Wir schwitzen zehn Stunden, und sie parfümieren sich. Jetzt hätten wir Gelegenheit, sie alle auf einen Schlag in ihren Himmel zu schicken.«
Aber das war nur so dahergeredet. Niemand rührte sich, es war zuviel Polizei um sie herum, und leben wollten sie alle noch ein wenig und ihren Anteil am Gold genießen.
Helena und Leonor gingen zu Pater Ernesto, der in der Tür des Kirchensaales stand. Thomas lag im noch offenen Sarg, umgeben von Kerzen, den Kränzen und der Totenwache Ribateios.
»Dürfen … dürfen wir ihn noch einmal sehen?« fragte Helena mit bebender Stimme. »Nur ganz kurz, Pater.«
»Geht hinein.«
Sie gingen langsam auf den Sarg zu und knieten rechts und links von ihm nieder. Es roch süßlich im Raum, Toms Gesicht sah fremd aus, aufgequollen von der Hitze. Helena betete laut das Vaterunser, begleitet von Leonors Schluchzen. Nach dem Amen erhoben sie sich und traten nahe an den Sarg heran. Helena griff sich an den Hals und zog ein goldenes Kreuz an einer goldenen Kette über den Kopf, das einzige Andenken, das sie von ihrer Mutter behalten hatte, gekauft mit dem Geld, das sie mit dem Dielenschrubben bei anderen Leuten verdient hatte. Es war das Kostbarste, das Helena zu geben hatte.
Leonor griff in die Tasche ihres Kleides und zog die Hand, zur Faust geballt, hinaus. Sie streckte die Faust über Toms Brust aus, öffnete die Finger und ließ eine große, lange Locke ihres Haares auf ihn schweben. Sie legte sie auf seine gefalteten Hände: ein letztes, dankbares Streicheln, ein liebender Gruß für die Ewigkeit. Dann faßten sie sich an die Hand und gingen mit gesenktem Kopf hinaus, blind vor Tränen.
Vor der Tür wartete Benjamim Bento.
Allein betrat er den Raum, sah den offenen Sarg, sah Toms Gesicht, wollte etwas sagen, wollte näher treten, aber dann ergriff ihn ein Schütteln, das ihn, den Riesen, fast umwarf. Er schlug beide Hände vors Gesicht und schrie in seine Finger hinein. Dann taumelte er zurück an die Wand und schlug mit der Stirn gegen die Mauer, immer und immer wieder.
Pater Ernesto, der die dumpfen Schläge gehört hatte, holte ihn aus dem Raum und hielt ihn im Flur fest.
»Benjamim, benimm dich wie ein Mann!« herrschte er ihn an.
»Er war mein einziger Freund.« Bentos Gesicht zuckte wie unter Krämpfen.
»Ja, und er war unser aller Freund.« Pater Ernesto drückte den weinenden Bento an seine Brust.
An dem Begräbnis nahm Luise nicht teil. Sie konnte es einfach nicht. Sie war unfähig, auch nur einen Schritt zum Grab zu gehen. Es war ihr unerträglich, die vielen ehrenden Worte zu hören, anzusehen, wie der Sarg langsam in die Grube gelassen wurde und wie man Schaufel um Schaufel Erde über ihn streute. Und völlig unerträglich war es ihr, die vielen Hände drücken zu müssen und in diese mitleidvollen Augen zu blicken.
Sie lag im Bett. Schwester Lucia und Margarida ließen keinen Besucher zu ihr. Luigi schraubte allein den Sarg zu, nachdem man den Deckel geschlossen hatte, erkannte Leonors Locke auf Toms Händen und legte darunter ein Bild von der Mission Santo Antônio, ein Polaroidfoto, das er gestern gemacht hatte.
Über dem Missionshaus bimmelte das alte Glöckchen, das seit der Gründung der Mission immer bei einem Begräbnis geläutet hatte. Luise schloß die Augen und atmete kaum. Und da war er bei ihr: sein Lachen, seine Jungenhaftigkeit und sein ärztlicher Ernst, seine Lippen, die hingebend küssen konnten, seine Hände, die über ihren Körper streichelten, seine Worte und seine Stimme, unter der sie erbebte, seine Zärtlichkeit und sein Sehnen nach ihrer Liebe, sein Haar, mit dem ihre Finger gespielt hatten.
Warte auf mich, dachte sie. Das Bimmeln des Glöckchens war wie ein ferner Ruf.
Weitere Kostenlose Bücher