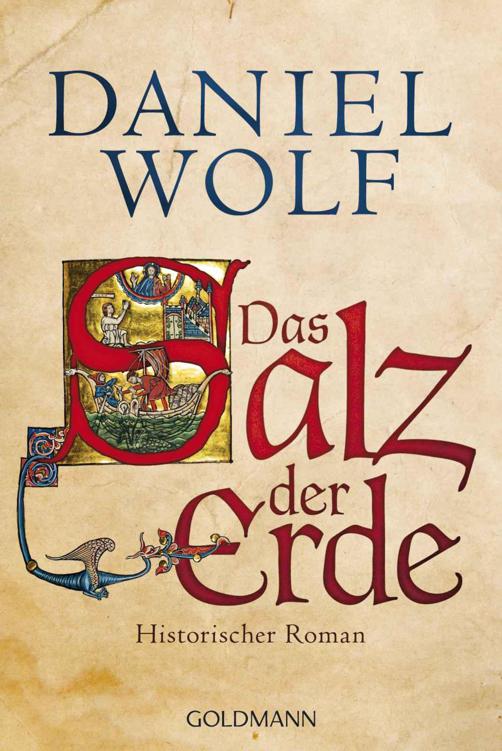![Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)]()
Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)
sich vor. »Und Ihr seid …?«
Der Hüne schritt gemächlich auf ihn zu.
Herrgott, wie groß ist dieser Kerl? Vier Ellen? Plötzlich erkannte er den jungen Edelmann. Es war Aristide de Guillory, Renards Sohn. Michel hatte ihn das letzte Mal vor vielleicht sechs, sieben Jahren gesehen, bevor Aristide die Burg seines Vaters verlassen hatte, um als Junker einem anderen Adligen zu dienen. Der Ruf der Grausamkeit eilte ihm voraus. Wer ihm begegnete, war gut beraten, vorsichtig zu sein.
»Ein wandernder Krämer, so.« De Guillorys Mundwinkel zuckten. »Ist das dein Gaul?«
Michel nickte.
»Was für ein unerwarteter Glücksfall. Nicht wahr, Berengar?«
»Sieht ganz so aus, Herr«, sagte der bullige Waffenknecht.
»Sei so nett und leih mir deinen Klepper«, wandte sich de Guillory an Michel.
»Wieso sollte ich das tun?«
»Nun, ich war mit meinen Männern jagen. Dabei ist mein Pferd gestürzt und hat sich so schwer verletzt, dass ich es töten musste. Leider sind es zwei lange Meilen bis zu meiner Burg, und ich habe wirklich keine Lust, zu Fuß zu gehen.«
»Es tut mir leid, aber ich kann Euch nicht helfen«, sagte Michel. »Ich brauche mein Pferd selbst.«
Der Ritter schaute zu Berengar, offenbar sein Sarjant. »Er versteht es nicht.«
»Ihr müsst es ihm deutlicher erklären, Herr.«
De Guillory lächelte Michel an und entblößte dabei strahlend weiße Zähne. »Verzeih. Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Es war keine Bitte. Es handelt sich vielmehr um eine Aufforderung.«
Die Männer feixten.
»Mit anderen Worten«, sagte Michel, »Ihr wollt mich zwingen, Euch mein Pferd zu überlassen.«
»Von Zwang kann keine Rede sein. Ihr Händler seid doch kluge Leute. Ich gehe deshalb davon aus, dass du so vernünftig bist, es mir freiwillig zu überlassen.«
»Das ist Raub!«
»Hör sich das einer an«, sagte de Guillory. »Große Worte für einen Krämer. Eine Leihgabe, mehr nicht. Morgen kannst du dir dein geliebtes Pferd zurückholen.«
Für einen Moment erwog Michel, sein Schwert zu ziehen und die Männer zu vertreiben, aber natürlich wäre dies eine ausgemachte Torheit. Zwar konnte er sich gegen Strauchdiebe verteidigen, doch diesen schlachtenerprobten Kriegern war er nicht gewachsen, schon gar nicht fünf von ihnen. So blieb er reglos stehen, bebend vor Zorn.
De Guillory schob ihn zur Seite und schwang sich in den Sattel. Maronne tänzelte und protestierte schnaubend gegen das ungewohnte Gewicht. Der Ritter zog ruckartig an den Zügeln, woraufhin sie gehorchte. »Das gehört dir, schätze ich.«
Er warf Michel das Schwert vor die Füße, schlug Maronne die Stiefelabsätze in die Flanken und jagte davon. Die Waffenknechte folgten ihm im Laufschritt. Es tat Michel weh, mitanzusehen, wie der Ritter die erschöpfte Stute hart zum Galopp antrieb.
»Ich werde mich bei Eurem Vater beschweren!«, brüllte er.
»Tu das. Ich empfehle dir einen guten Geisterbeschwörer«, rief de Guillory, bevor er zwischen den Bäumen verschwand.
Fluchend warf Michel sein Gepäck auf den Boden.
Erschöpft, müde und gereizt schlurfte er einige Stunden später die alte Römerstraße entlang. Das Schwert hatte er sich umgegürtet und die Satteltaschen über die Schulter gehängt. Obwohl die Sonne bereits den Hügeln im Westen entgegensank, brannte sie immer noch heiß.
Zu seiner Rechten floss die Mosel. Hier, nur wenige Tagesmärsche flussabwärts der Quelle, war sie gerade einmal dreißig, vierzig Ellen breit und im Sommer so flach, dass man an manchen Stellen ohne größere Mühe hindurchwaten konnte. Ihre Ufer waren steil und felsig und von dichtem Gestrüpp bewachsen. Der beschauliche Anblick des Flüsschens ließ einen manchmal vergessen, dass es sich dabei um eine alte, unberechenbare Naturgewalt handelte. In Ufernähe gab es tückische Stromschnellen, und im Frühjahr, während der Schneeschmelze, schwoll sie bedrohlich an und verwandelte sich in einen reißenden Wasserlauf.
Seit der Begegnung mit de Guillory hatte Michel keinen Blick mehr für die Schönheit des Moseltals. Als Varennes-Saint-Jacques vor ihm auftauchte, gelang es ihm nicht, sich darüber zu freuen, nach so langer Zeit endlich nach Hause zu kommen – im Gegenteil, er erschrak.
Obwohl ihm stets klar gewesen war, dass sich seine Heimatstadt nicht mit den prachtvollen Metropolen Norditaliens messen konnte, hatte er nie aufgehört, sie zu lieben. In seiner Erinnerung besaß sie bei aller Rückständigkeit einen ganz eigenen Liebreiz, der die
Weitere Kostenlose Bücher