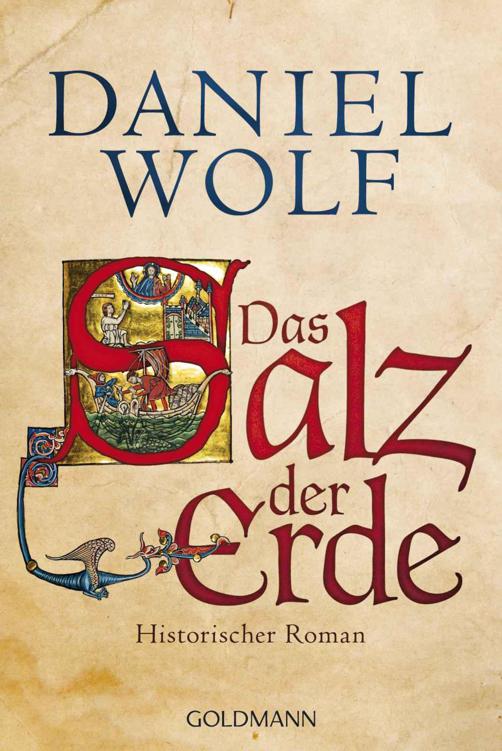![Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)]()
Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)
Varennes-Saint-Jacques eine Spende von zweiundsechzig Pfund.«
»Nein«, sagte Michel. »Das ist zu viel. Das nehme ich nicht hin. Unser Besitz ist nie und nimmer so viel wert.«
»Allein der Grund und Boden und Euer Haus kosten gut und gerne hundertdreißig Pfund. Hinzu kommen das Vieh, die Bücher, die Gewürze in der Vorratskammer, Wandteppiche, Gewänder, sechs kupferne Leuchter und das Geld. Dreihundertzehn Pfund ist noch wohlwollend geschätzt, Herr de Fleury. Akzeptiert es, oder ich komme morgen mit zwei Bütteln wieder, wir begutachten Euer Hab und Gut gründlich, und dann werde ich nicht so mildtätig sein.«
Das war keine leere Drohung. Als höchster Amtsmann des Bischofs konnte Martel nach Belieben mit ihnen verfahren, er konnte sogar ihr Haus auf den Kopf stellen und einzelne Besitztümer beschlagnahmen, wenn es ihm gefiel. Michel blieb nichts anderes übrig, als einmal mehr seinen Zorn zu schlucken und sich zu fügen. »Also gut«, brachte er hervor. »Zweiundsechzig Pfund. Aber ich entscheide, wer sie bekommt.«
»Gewiss«, sagte Martel. »Das ist Euer gutes Recht. Wenn ich Euch eine Empfehlung geben darf: Spendet Euren Freiteil dem Domkapitel. Der Propst braucht Geld für die Erneuerung des Glockenturms.«
Michel dachte nicht im Traum daran, sein Silber dem Propst in den Rachen zu werfen. Die Pfaffen vom Domkapitel waren reicher als so mancher lombardische Geldverleiher. Wenn er schon eine solche Summe spenden musste, sollte sie wenigstens den wirklich Bedürftigen zugutekommen, den bedauernswerten Insassen des Leprosoriums oder den Armen im Spital der Abtei Longchamp.
»Ich werde darüber nachdenken.«
»Tut das. Aber nicht zu lange. Wenn Eure Spende nicht bis Johanni bei einer Einrichtung des Bistums eingegangen ist, habt Ihr Euch vor dem Sendgericht zu verantworten.«
Mit diesen Worten empfahl sich der Schultheiß.
»Dieser Leichenfledderer!«, fluchte Michel, als Martels schleppende Schritte verklungen waren. »Das hat ihm richtig Vergnügen bereitet, hast du gesehen? So ein Halunke!« Er trat ans Fenster und sah den Schultheißen über den Domplatz hinken. »Ein eiterndes Furunkel soll ihm wachsen!«
Jean stand mit starrem Blick neben der Tür. »Ist er weg?«
»Ja! Hoffentlich holt ihn der Teufel!«
Sein Bruder zog zwei Silberlöffel, einen kleinen Zinnteller und ein Säckchen mit Pfefferkörnern aus seinem Wams. »Das ist alles, was ich retten konnte. Ich wollte auch das Kruzifix in der Stube verschwinden lassen, aber er ist mir zuvorgekommen. Heiliger Jesus am Kreuz, dieser Mann hat Augen wie ein Luchs!«
Thérese kam herein. »Pater Jodocus ist da. Soll ich ihn heraufbitten?«
Michel rieb sich die Augen. Dieser Tag war noch nicht vorüber, doch er fühlte sich bereits so erschöpft wie nach einer zweiwöchigen Handelsreise. »Komm«, sagte er zu seinem Bruder. »Teilen wir unser Erbe auf. Das bisschen, was noch übrig ist …«
»Euer Vater war ein gesunder und starker Mann, der den Gefahren seines Berufs stets mit Umsicht begegnet ist«, sagte Pater Jodocus, als sie im Saal zusammensaßen. »Jeder, der ihn kannte, war sicher, dass er noch viele Jahre vor sich habe. Auch er selbst dachte das. Deshalb hat er nie mit mir darüber gesprochen, was mit seinem Besitz geschehen soll, wenn der Herr ihn dereinst zu sich holt. Wir müssen also nach bestem Gewissen versuchen, seine Wünsche zu ergründen. Ich bin davon überzeugt, er wollte vor allem anderen, dass das Geschäft, das er so mühevoll aufgebaut hat, wächst und gedeiht und dem Wohlergehen der Familie dient. Stimmt ihr mir zu?«
»Davon können wir ausgehen«, antwortete Michel, und Jean nickte.
Der Priester stellte seinen Weinkelch auf den Tisch. Er war ein Mann von dreiundfünfzig Jahren, der mit seinem weißen Vollbart und dem kahlen, vernarbten Schädel mehr wie ein alter Soldat denn wie ein Geistlicher aussah. Tatsächlich hatte er in jungen Jahren im Heiligen Land gegen die Sarazenen gekämpft, bevor er seine Bestimmung fand. »Jedem von euch steht eine Hälfte des Familienbesitzes zu«, fuhr er fort. »Da euer Vater wollte, dass ihr das Geschäft gemeinsam weiterführt, wäre es jedoch nicht in seinem Sinne, das Vermögen unter euch aufzuteilen. Sind wir uns darin einig?«
»Natürlich«, sagte Michel. »Aber genau da liegt die Schwierigkeit. Es war gewiss nicht sein Wunsch, dass einer von uns alles bekommt und der andere nichts.«
»Und wenn du mich ausbezahlst?«, erwiderte Jean. »Es ist doch so: Wir alle wissen,
Weitere Kostenlose Bücher