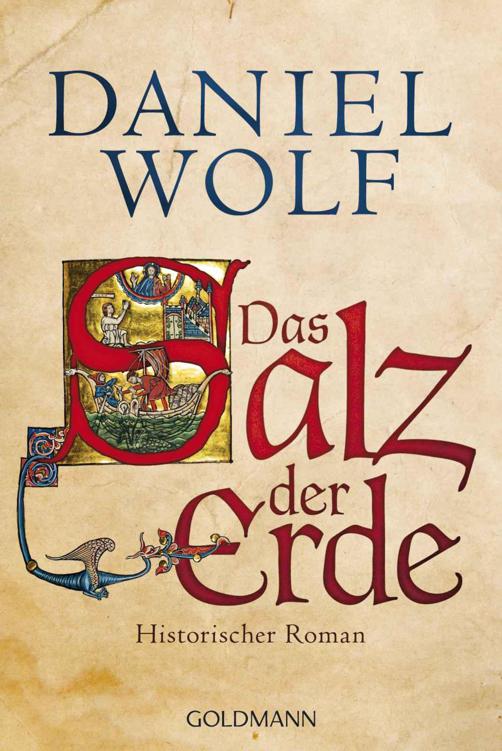![Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)]()
Das Salz der Erde: Historischer Roman (German Edition)
dass ich nicht zum Kaufmann tauge …«
»Das ist Unsinn, was du da sagst.«
»Warum soll ich mir etwas vormachen, Michel? Mit unverschämten Kunden und gierigen Kleinkrämern zu feilschen und nächtelang dazusitzen und Deniers zu zählen – das ist nichts für mich. Ich bin dafür nicht geschaffen. Wenn ich mit dem Salzschiff auf der Mosel fahren und hier und da mit anpacken darf, bin ich vollauf zufrieden. Du dagegen bist der geborene Händler. Du verstehst etwas von Geld und hast eine Nase für gute Geschäfte. Deshalb hat Vater auch dich nach Mailand geschickt und nicht mich. Er wollte, dass du einmal das Geschäft leitest. Also wäre es vernünftig, wenn du das Haus, das Vieh und den übrigen Besitz bekommst und mich dafür ausbezahlst. Sagen wir, du gibst mir hundertzwanzig Pfund. Das wäre ungefähr die Hälfte dessen, was Martel geschätzt hat, den Freiteil abgezogen. Damit wäre mein Anteil abgegolten, und die künftigen Gewinne teilen wir einfach durch zwei.«
Michel hätte ihm gern widersprochen, doch insgeheim wusste er, dass sein Bruder recht hatte. Schon als Heranwachsender hatte Jean kaum Interesse für kaufmännische Dinge aufgebracht und sich stets gelangweilt, wenn ihr Vater das Treiben auf den Handelsmessen erklärt oder ihnen erläutert hatte, wie sich die Münzen der verschiedenen Städte voneinander unterschieden. Er liebte die einfache Arbeit: Waren auf- und abladen, die Saumtiere pflegen, ein gebrochenes Wagenrad ersetzen, das Haus instand halten. Anders als seine Geschwister schlug er gänzlich nach ihren bäuerlichen Vorfahren, die seit Generationen in Fleury die Felder bestellt und dem Land karge Frucht abgerungen hatten.
Jean hatte ohne Bitterkeit und Neid gesprochen. Offenbar hatte er sich schon lange damit abgefunden, dass ihm ein schlichtes Leben im Hintergrund vorbestimmt war, während sein älterer Bruder einer glanzvollen Laufbahn als Kaufmann und Oberhaupt der Familie entgegenging. Seine Bescheidenheit rührte Michel eigentümlich, und er wusste nicht, was er sagen sollte.
»Ich möchte, dass du etwas weißt, Jean«, brach Pater Jodocus schließlich das Schweigen. »Michel mag besser geeignet sein, die Nachfolge eures Vaters anzutreten, aber auch du bist ein Sohn, auf den jeder Mann stolz wäre. Du hast nicht nur Rémys Gottesfurcht und unerschütterliche Zuversicht geerbt, sondern auch seine Stärke, seine Güte und seinen Mut. All das ist genauso viel wert wie Klugheit und Geschäftssinn, wenn nicht mehr. Vergiss das niemals.«
Michel erschien es, als wäre sein Bruder soeben zwei Fingerbreit gewachsen. Wieder einmal hatte Jodocus die richtigen Worte gefunden.
»Jean auszubezahlen ist trotzdem keine Lösung«, sagte Michel. »Wenn wir den Freiteil entrichtet haben, ist kein Geld mehr da – wir müssten das Haus verkaufen, und das will ich nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden.«
»Du musst ihn nicht auf einen Schlag ausbezahlen«, erwiderte Jodocus. »Macht es wie die Gebrüder Nemours. Als sie damals das Geschäft ihres Vaters erbten, standen sie vor denselben Schwierigkeiten wie ihr. Sie haben sich darauf geeinigt, dass Jacques seinem jüngeren Bruder Aimery jedes Jahr bis an sein Lebensende eine Leibrente zahlt.«
Michel schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Eine Rente, natürlich! Wieso bin ich nicht von selbst darauf gekommen? Wärst du damit einverstanden?«, wandte er sich an seinen Bruder.
»Ich denke schon. Es kommt natürlich darauf an, wie hoch die Rente wäre.«
Michel dachte kurz nach. »Was hältst du von sechs Pfund Silber im Jahr? Zusätzlich bekommst du die Hälfte aller Einkünfte aus dem Geschäft.«
Jean nickte. »Hört sich gut an.«
Michel fiel ein Stein vom Herzen. Obwohl Jean und er sich ausgezeichnet verstanden, hatte er befürchtet, sie könnten sich zerstreiten – sie wären wahrlich nicht die ersten Brüder gewesen, die sich wegen ihres Erbes entzweiten.
»Ich wusste, es war die richtige Entscheidung, Euren Rat einzuholen.« Michel hob seinen Kelch. »Lasst uns trinken. Auf Eure Gesundheit, Pater Jodocus.«
Rubinroter Wein schwappte auf das dunkle Holz, als sich die drei Kupferbecher über dem Tisch trafen.
Kurz nachdem der Geistliche gegangen war, kam ein Knecht von Gaspard Caron und überbrachte Michel eine Nachricht.
Lieber Freund, schrieb Gaspard in seiner gestochen scharfen Handschrift, wie schön, dass Du wieder zu Hause bist! Es wäre mir eine Freude, Dich heute Abend zu treffen. Komm zur Vesper zu Pierres
Weitere Kostenlose Bücher