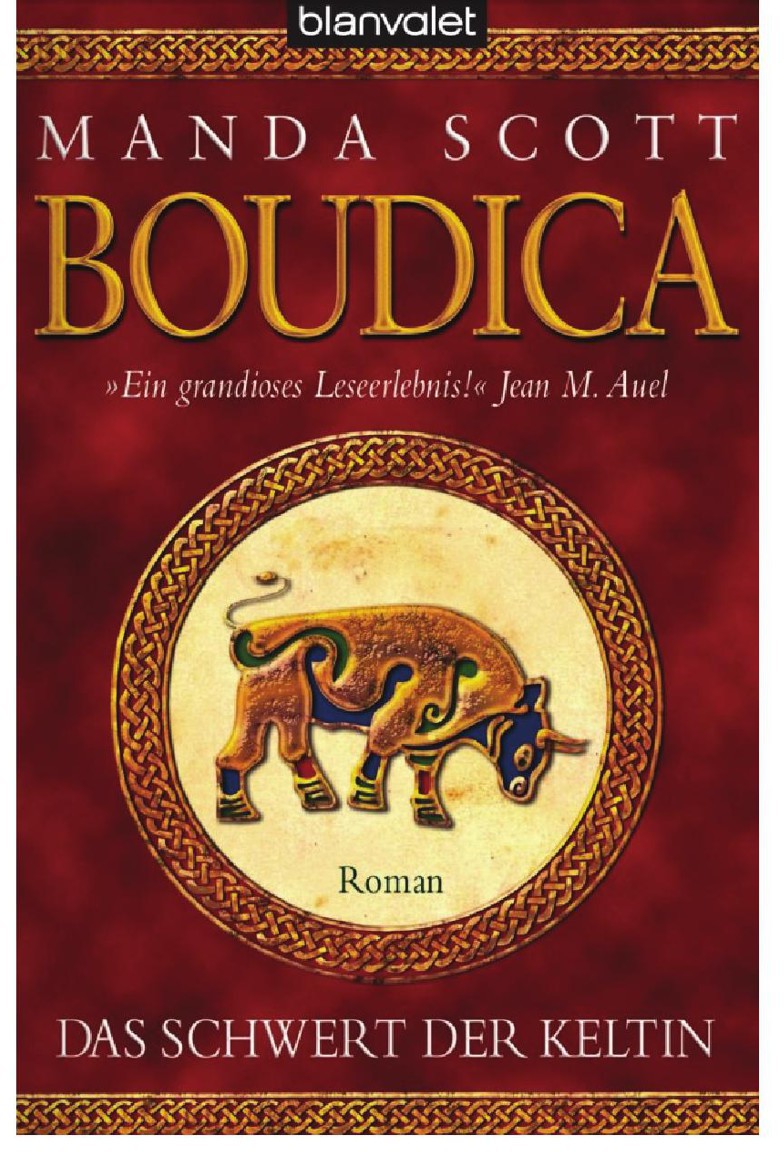![Das Schwert der Keltin]()
Das Schwert der Keltin
eben gehört hatte, ihn irritierte. Vorsichtig zündete Valerius die Fackel wieder an, um mehr Licht zu haben, und dann entdeckte er - zusammengekrümmt auf der anderen Seite des Feuers in der dunkelsten Ecke der Hütte hockend - eine Frau, älter noch als jede, die er draußen auf dem Anwesen gesehen hatte. Ihr Gesicht glich der zerfurchten Rinde einer uralten Eiche, ihr Haar war so dünn geworden, dass sie fast kahlköpfig war und nur noch einige wenige schlohweiße Strähnen auf ihrer rosa Kopfhaut sprossen. Ihre Augen waren seltsam klar, wo Valerius Trübheit erwartet hätte. Sie war eine echte Großmutter, und in der Menschenmenge, die sich draußen versammelt hatte, hatte es keine Einzige wie sie gegeben. Das hätte ihm eigentlich auffallen müssen, aber er hatte es nicht bemerkt. Er fluchte über seine Unaufmerksamkeit.
Die alte Frau beobachtete ihn mit dem starren, wachsamen Blick eines Raubvogels oder auch einer Drossel, die in einem Dunghaufen nach Käfern und Würmern sucht. Erstaunlicherweise lächelte sie. »Willkommen, Träumer. Ich warte schon seit Tagesanbruch auf dich. Aber offenbar hast du es nicht so eilig, wie ich eigentlich dachte.«
Schon wieder dieses Wort, und dazu ein Ton, der geradewegs aus seiner Kindheit zu kommen schien. Dein Zeichen hätte das Pferd sein können. Oder auch der Hase … Valerius fühlte, wie ihm ein kalter Schauder über den Nacken rieselte. »Ich bin kein Träumer«, entgegnete er.
»Kein Träumer? Ach je. Deine Mutter wäre traurig, wenn sie das hörte.«
»Meine Mutter?« Das Schwert in seiner Hand zitterte, als wäre es ein lebendiges Wesen. Nur mit Mühe gelang es ihm, dieses Wesen zu bändigen. »Meine Mutter ist tot.«
»Ihr Sohn anscheinend auch - wenn auch nicht körperlich, so doch auf jeden Fall seelisch.« Die Alte grinste über sein sichtliches Unbehagen. »Warum bist du hier?«
»Um Waffen einzusammeln. Rom möchte Ruhe und Frieden haben. Und dies ist ein Mittel, um Frieden zu schaffen.«
»Wenn du mit Frieden Unterjochung meinst, dann ja.« Sie legte den Kopf schief. »Na schön, wenn du mir keine klare Antwort geben willst, dann werde ich meine Frage eben anders formulieren. Warum sammelst du für Rom Waffen ein - ausgerechnet du, der du doch dazu geboren wurdest, gegen Rom zu kämpfen?«
Er schwankte auf den Füßen. In der Dunkelheit hallte das Schweigen des Gottes wider, genau wie damals in der Weinkeller-Krypta. Mit einer Stimme, so leise, dass sie unterhalb der Hörschwelle lag, sprach seine Mutter die Litanei seiner Albträume: Du bist allein und verlassen. Die Götter haben dich zum Leben verdammt.
Mit rauer, gepresster Stimme erwiderte Valerius: »Ich habe keine andere Wahl.«
»Ha! Und das aus dem Munde eines Mannes, der sich zu dem Stier bekannt hat!« Die alte Frau war gerade damit beschäftigt, dürre, trockene Zweige ins Feuer zu legen. Kleine Flammen tanzten in den wabernden Schatten. Würziger Rauch stieg Valerius in die Nase. Ein alter, vergessener Teil seines Ichs entschlüsselte automatisch die einzelnen Bestandteile: Rotdorn, Eberesche, Eibe. Er nieste prompt, als er einen Moment später einen Geruch wahrnahm, der sehr viel strenger war als der der verschiedenen Hölzer. Verwirrt dachte er nach, bis ihm der Geruch abermals in die Nase stieg und er die Bitterkeit angesengten Haares erkannte. Keine Großmutter verbrannte Tierhaare, ohne die Kräfte, die ihnen innewohnten, zu beschwören.
»Was machst du da?«, fragte er.
»Sieh selbst.«
Sie reichte ihm eine Hand voll dürrer Zweige von dem Brennholzstapel neben ihr. Valerius benutzte das Licht des Feuers, um diejenigen herauszusuchen, die mit Haar umwickelt waren. Als er eines dieser Bündel auseinander nahm, entdeckte er etwas, von dem er bereits geahnt hatte, dass er es dort finden würde: gekräuselte Haare in Rot und in Weiß vom Schädel eines rot-weiß gefleckten Stiers. Valerius ließ sie alle ins Feuer fallen. Dichter Rauch stieg fächerförmig auf, um seinen Kopf anzufüllen. In seiner momentanen Benommenheit hörte er viele lachende Frauenstimmen und das Brüllen eines Stiers bei der Kastration. Es überlief ihn eiskalt. Die Knochen seines Skeletts schienen sich von seinem Fleisch zu lösen. Er schmeckte den Tod und eine Angst, wie er sie selbst in Schlachten noch nie erlebt hatte. Abermals, diesmal mit einem unüberhörbaren Unterton von Verzweiflung in der Stimme, sagte er: »Mir bleibt einfach nichts anderes übrig. Ich hatte zu der Zeit der Schlachten keine
Weitere Kostenlose Bücher