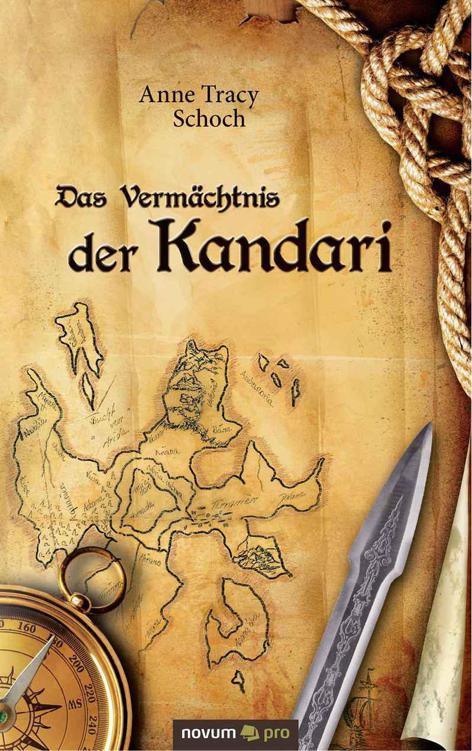![Das Vermächtnis der Kandari (German Edition)]()
Das Vermächtnis der Kandari (German Edition)
eine bunte Jahreszeit war ohne die Schwermut des Vergehens. Die Blätter, die in allen Farben strahlten, hingen an den Bäumen, bis plötzlich der Winter kam und das ganze Land unter einer dicken Schneedecke verbarg. Doch in diesem Jahr schienen die leuchtenden Gelbtöne ihrer verzweifelten Lage zu spotten und das rot gefärbte Laub wirkte wie eine Verkörperung des Meeres aus Blut und Leid, welches das Königreich der Menschen hinfortzuspülen drohte.
Schließlich, sie ritten gerade über eine scheinbar unendliche Ebene, brach François das Schweigen: „Der Weg nach Navalia ist allzu lang, um ihn in vollkommener Stille zurückzulegen.“
Larenia lächelte, doch dann drehte sie sich, einem plötzlichen Gedanken folgend, zu ihm um: „Dann erkläre mir eins: Warum hast du Hamada damals verlassen? Ich habe es nie ganz verstanden. Nichts hat dich mit dem Aufstand in Verbindung gebracht. Du warst erfolgreich bei den Bewahrern und dein Gewissen hat dich zuvor nie gequält. Warum also bist du nicht geblieben?“
François zuckte mit den Schultern: „Das Gleiche könntest du Felicius fragen“, seine Stimme klang ungeduldig, er sprach nicht gern über die Vergangenheit.
„Felicius ist ein Idealist. Allein die Vorstellung von sozialer Ungerechtigkeit genügt, um ihn unglücklich zu machen. Was ist mit dir?“
Er seufzte: „Ebenso wie Arthenius bin ich bei den Bewahrern aufgewachsen, aber ich hatte keinen idealistischen Bruder, der meinen Blick für die Probleme des Volkes geschärft hätte. Ich habe keinen Gedanken an die Konsequenzen des Tuns der Bewahrer verschwendet. Doch nach dem Aufstand konnte ich mich nicht länger blind stellen. Ich konnte nicht mehr den Blick abwenden oder verdrängen, was die Bewahrer, was ich dem Volk angetan hatte. Ich hätte nicht bleiben können. Lieber führe ich ein Leben im Exil.“
Larenia sah ihn lange Zeit an, als versuche sie zu ergründen, was hinter seinen Worten lag. Es war ein sanfter, verständnisvoller Blick. Nach einer Weile versank sie wieder in ihren Gedanken.
François beobachtete sie. Nach all den Jahren, die sie zusammengelebt hatten, kannte er Larenia und die Nuancen ihres Verhaltens gut genug. Sie war nie überschwänglich oder redselig gewesen. Nicht einmal Arthenius erzählte sie alles, was sie wusste oder plante. Doch normalerweise zögerte sie nicht, die Fähigkeiten jedes einzelnen Gildemitglieds ebenso wie ihre eigenen zu nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Jetzt jedoch distanzierte sie sich immer mehr von ihrer Umgebung. Still und verbissen versuchte sie, nahezu unmögliche Aufgaben allein zu lösen, und sie sprach kaum noch mit jemandem. Inzwischen hatte ihre Verschwiegenheit schon auf die anderen Gildemitglieder abgefärbt. Auch jetzt zögerte François lange, ehe er sprach: „Was ist nur mit dir los, Larenia?“
Überrascht und verständnislos sah sie ihn an.
„Du ziehst dich von allem zurück, versuchst, alles allein zu tun. Im letzten Monat hast du mit keinem von uns mehr als zehn Worte gesprochen. Und ich wüsste gern, warum.“
Sie zog die Augenbrauen hoch. Niemand, außer Arthenius und in seltenen Momenten Pierre, stellte ihre Handlungen infrage und Larenia rechtfertigte sich vor keinem. Auch jetzt würde sie nicht antworten, erkannte François. So fuhr er mehr im Selbstgespräch als an sie gewandt fort: „Ich frage mich, was du in den Brochoniern siehst. Für dich scheinen sie mehr zu sein als ein Feind, den es zu besiegen gilt. Und mehr dürften sie für dich nicht darstellten. Du weißt zu wenig über die Zeit vor dem ersten Zeitalter, nachdem sich die Völker getrennt haben. Du kennst den Groll zwischen den Menschen und den Kandari nicht oder nur aus alten Geschichten. Und trotzdem hast du diesen Krieg zu deiner persönlichen Aufgabe gemacht. Ich würde gern den Grund verstehen.“
Larenia seufzte. Nicht entnervt oder verärgert, sondern vielmehr wie jemand, der lange über eine schwierige Aufgabe nachgegrübelt hat, ohne die Antwort zu finden.
„Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Ich sehe die Brochonier an und frage mich, wie viele unter ihnen so sind wie Julius, Logis oder Rowena und Norvan. Oder so wie du und ich. Sie sind nicht alle grausam. Irregeführt vielleicht, verblendet von jahrelang geschürtem Hass. Aber welches Recht habe ich, über sie zu urteilen? Ihre Druiden haben nahezu die gleichen Kräfte wie wir. Und nach allem, was ich getan habe und vielleicht noch tun werde, frage ich mich, was mich noch von ihnen
Weitere Kostenlose Bücher