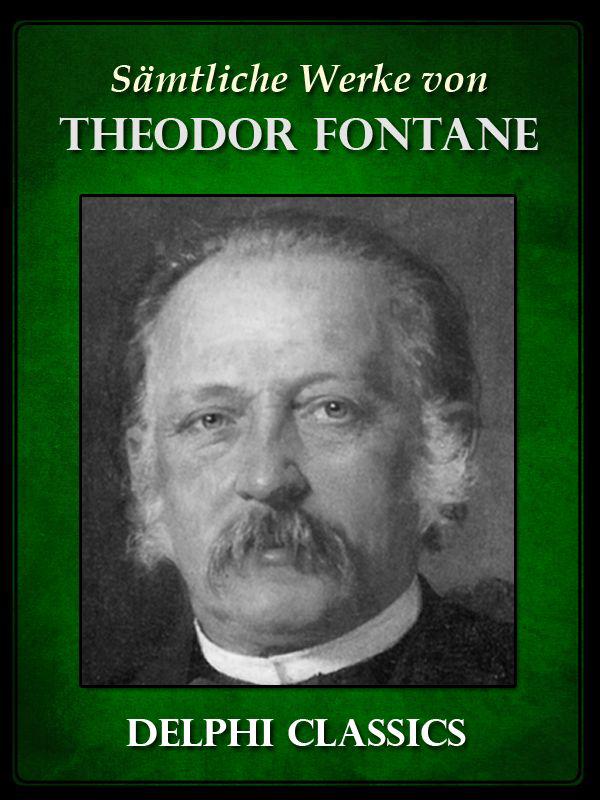![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
Soldatenkönigs, am wenigsten aber an den Kämpfen und Gestaltungen unserer eigenen Tage völlig achtlos vorübergeht. Freilich nicht jeder Abschnitt, mit vielleicht alleiniger Ausnahme des ersten (der Quitzowzeit), kommt zu seinem Recht, aber doch immerhin zur Erwähnung, und wenn sich auf dem Gebiete der eigentlichen Landesgeschichte sicherlich breiteste Lücken finden, so finden sich dafür auch Mitteilungen und Beiträge, die vielleicht geeignet sind, auf dem Gebiete der Kulturhistorie vorhandene Lücken zu schließen.
Vielen Gönnern und Freunden – und nicht zum letzten der bei meinen vielen Anfragen nie lässig oder ungeduldig werdenden Lehrerschaft von Wilsnack und Umgegend – bin ich für ihre freundliche Mitarbeit zu lebhaftem Danke verpflichtet, am meisten freilich den Familien Knyphausen (auf Lützburg in Ostfriesland) und Eulenburg , ohne deren Hülfe die Kapitel Hoppenrade und Liebenberg nicht geschrieben werden konnten. – Alle von mir benutzten Bücher sind, meines Wissens, im Texte genannt worden, mit alleiniger Ausnahme (weshalb ich es hier nachhole) des E. Handtmannschen Buches »Neue Sagen aus Mark Brandenburg«, einer trefflichsten Sagensammlung, der ich, in dem Quitzöwel-Abschnitt, den Stoff zur Geschichte von »Quitzow dem Judenklemmer« und überhaupt alles auf die Eldenburg Bezügliche entnommen habe.
Berlin, 20. September 1888
Quitzöwel
1. Kapitel
Dietrich und Johann von Quitzow im väterlichen Hause bis 1385
Ganz in der Nähe der Einmündung der Havel in die Elbe, zwei Stunden unterhalb Havelberg, liegt Dorf Quitzöwel. Ersteigt man, um Umschau zu halten, den Turm der wenigstens an ihrem Giebel noch gotischen alten Kirche, so gewahrt man, nach Norden hin, das reiche, früher zu Bistum Havelberg gehörige Dorf Legde (jenseits desselben die Wilsnacker Wunderblutkirche), während, nach Süden zu, die Rauchfahnen auf und ab fahrender Schleppdampfer die Stelle bezeichnen, wo hinter dem hohen Elbdamm, und deshalb unsichtbar, die Elbe selbst ihren Lauf nimmt. Soweit der Blick in die Ferne. Zu Füßen des uns Umschau gönnenden Turmes aber steigt ein aus Wiesen und Eichengruppen malerisch zusammengestellter Park und aus ebendiesem Park ein Herrenhaus auf: das gegenwärtige Schloß Quitzöwel . Das ist die Stelle, wo die Stammburg der berühmten Quitzowfamilie stand. Überbleibsel der alten Umfassungsmauern werden noch gelegentlich in großen Steinblöcken ausgegraben, und ein bis heute dem modernen Schlosse verbliebenes Stück Wallgraben erinnert an alte, längst zurückliegende Burgtage. Sonst verlautet nichts von Beschaffenheit und Umfang der ursprünglich hier gelegenen Quitzowstätte, während wir über alle diejenigen, die während der sogenannten »Quitzowzeit« diese Stätte bewohnten, verhältnismäßig gut unterrichtet sind. Einer der interessantesten Abschnitte der märkischen Geschichte, vielleicht der interessanteste, hat in einem Mitlebenden, dem Kleriker Engelbert Wusterwitz, einen Chronisten gefunden, und unsere besten Spezialhistoriker, wie Raumer, Riedel, Klöden, haben das uns von Wusterwitz Überlieferte durch Heranziehung urkundlichen Materials bereichert und berichtigt. Wenn trotzdem hier abermals der Versuch einer Darstellung der Quitzowepoche gemacht wird, so geschieht es nicht, weil Neues vorläge, Neues, das vom Standpunkte der Forschung aus dazu auffordern könnte, sondern lediglich in der Absicht den in kleinen und, was schlimmer, in oft unterschiedslosen Details erstickenden Stoff übersichtlicher zu gestalten und durch größere Klarheit und Konzentration seine dramatische Wirkung zu steigern. Erst in den Schlußkapiteln dieses Aufsatzes werd ich in der angenehmen Lage sein, meinen Lesern auch minder bekannt Gewordenes, weil einer andern späteren Epoche Zugehöriges, aus dem berühmten Quitzowhause zur Kenntnis zu bringen.
Wann die Quitzows, deren im Jahre 1295 zuerst Erwähnung geschieht, Dorf und Haus Quitzöwel in ihren Besitz brachten, ist nicht mit Bestimmtheit festzustellen gewesen, ebensowenig wie die Namen und Reihenfolge der Besitzer bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Wir wissen nur, daß, als Kaiser Karl IV. um die Mitte der siebziger Jahre nach Mark Brandenburg kam, Köne von Quitzow, ein »alter und hoflicher Reuter«, wie der Chronist sich ausdrückt, auf Burg Quitzöwel saß. Das Ansehen, das er genoß, so groß es war, war ein rein persönliches und erwuchs ihm weder durch seinen keineswegs ausgedehnten Besitz noch durch
Weitere Kostenlose Bücher