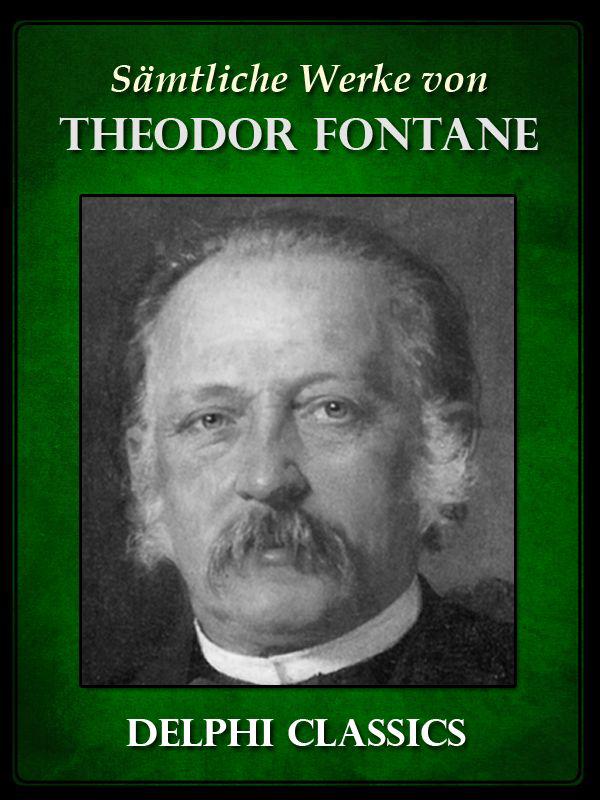![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
dem ganzen romantischen Reize mittelaltrigen Rittertums, aber gerade von ritterlichem Sinn und ritterlicher Sitte sucht man in dem wirren Treiben jener Tage vergeblich eine Spur.«
Und nach diesen einleitenden und das Allgemeine treffenden, ja aufs allgemeine hin angesehen auch zutreffenden Bemerkungen wendet sich Riedel, wie zur Bestätigung seiner Sätze, verschiedenen Einzelheiten zu.
»Ritterlich! Ja, ritterlich wäre es gewesen, der Wehrlosen zu schonen, Frauen und Jungfrauen zu beschützen und in tätiger Gottesfurcht die Kirche gegen Entweihung zu verteidigen. Aber von unseren Landesbeschädigern wurde der offene Kampf mit dem Feinde meistens vorsichtig vermieden. Mit Vorliebe machte man sich den Überfall der offenen Dörfer und den Raub der städtischen Viehherden zum Geschäft. Wollte man ein Dorf ›auspochen‹, so mußten gewöhnlich erst einige Männer totgeschlagen oder furchterregend verwundet werden, um die Einwohnerschaft von weiterem Widerstande abzuschrecken. Dann nahm man den Dorfbewohnern, was sich fortbringen ließ, vornehmlich das Vieh, aber auch Betten, Kleidungsstücke sowie Kessel, Grapen, Äxte und sonstige Geräte. Die Kleidungsstücke zog man in mehr als einem Falle den Frauen und Jungfrauen vom Leibe, besonders wenn sie kostbar waren. Schätzte doch die Tochter des Schulzen zu Hämerten bei Stendal, der man die Kleider nahm, nachdem man den Vater getötet und den Bruder schwer verwundet hatte, ihre Kleider auf drei Schock böhmische Groschen, eine damals beträchtliche Summe. Nicht einmal Klosterjungfrauen wurden verschont. Als dem Lüdeke von Bundstedt, der von der Burg Gardelegen ausritt, zwei Nonnen aus dem Kloster Althaldensleben zu Wagen begegneten, nahm er ihnen nicht nur die Pferde, sondern zog auch den Hofemeister, der sie fuhr, vor ihren Augen aus. Dabei schwand die fromme Scheu mehr und mehr, die man vor dem Heiligen, vor Kirchhof und Kirche gehabt hatte. Rücksichtlos griffen die Quitzowschen die Gotteshäuser an, in denen die bedrängten Dorfbewohner Schutz gesucht hatten, und nachdem die Kirchhöfe gestürmt und die Kirchtüren erbrochen waren, raubte man die Kisten und Kasten aus, die die geängstigten Dorfleute nach der früher als Asyl geltenden Kirche geschafft hatten. Unter diesen Umständen durfte niemand überrascht sein, Dietrich von Quitzow, als er dem Deutschen Orden zu Hülfe ziehen wollte, seinen Entschluß wechseln und statt eines Angriffs auf die Polen, unter nichtigen Vorwänden, einen Angriff auf die Berliner Viehherden machen zu sehen. Mit dem ritterlichen Zuge gegen die Feinde des Ordens aber war es vorbei. Solche › Zugriffe ‹, ›Nahmen‹ und ›Überfahrungen‹ – Ausdrücke, die sich in den Berichten jener Zeit beständig wiederholen – waren damals an der Tagesordnung, und es ist zuzugeben, daß es bei dem eigentümlichen Fehderecht jener Zeit nicht immer leicht sein mag, eine scharfe Grenze zwischen ›Zugriffen‹ und Raubtaten zu ziehen. Wenn jedoch gegen die Bezeichnung solcher ›Zugriffe‹ als Raubtaten durch hochgeschätzte Geschichtsschreiber feierlich Verwahrung eingelegt und dabei behauptet worden ist, nur aus einer der Natur der Sache ganz unangemessenen parteiischen Auffassung des gleichzeitigen Berichterstatters Wusterwitz (wir kommen auf diesen zurück) und urteilsunfähiger neuerer Historiker habe eine so ungeeignete Bezeichnung hervorgehen können, so nötigt uns dies, zur Ehre der Wahrheit, die Bemerkung hinzuzufügen, daß wenigstens der damalige Erzbischof von Magdeburg und der Burggraf Friedrich selbst diese Bezeichnung keineswegs für ungeeignet gehalten haben. Beide Fürsten bezeichnen in ihren amtlichen Schriftstücken die Gewalttaten der Quitzows, des Kaspar Gans und Wichard von Rochow überaus häufig als Raub, Mord und Mordbrand und deren Urheber in entsprechender Weise. Und so ist es denn nicht bloß ein vielleicht parteiischer Geschichtsschreiber jener Zeit, der von ›Räubereien‹ spricht, sondern alle gleichzeitigen Berichterstatter des In- und Auslandes stimmen mit Wusterwitz durchaus überein.«
Alle diese Bemerkungen, soweit sie polemisch sind und eine durch »Standesvorurteile bedingte Voreingenommenheit hochgeschätzter Geschichtsforscher« betonen, richten sich gegen Georg Wilhelm von Raumer – einen Vetter des sogenannten Hohenstaufen-Raumer –, der, in seinem »Codex diplomaticus brandenburgensis«, den darin von ihm veröffentlichten, die Regierungszeit Kurfürst Friedrichs I. von 1412 bis
Weitere Kostenlose Bücher