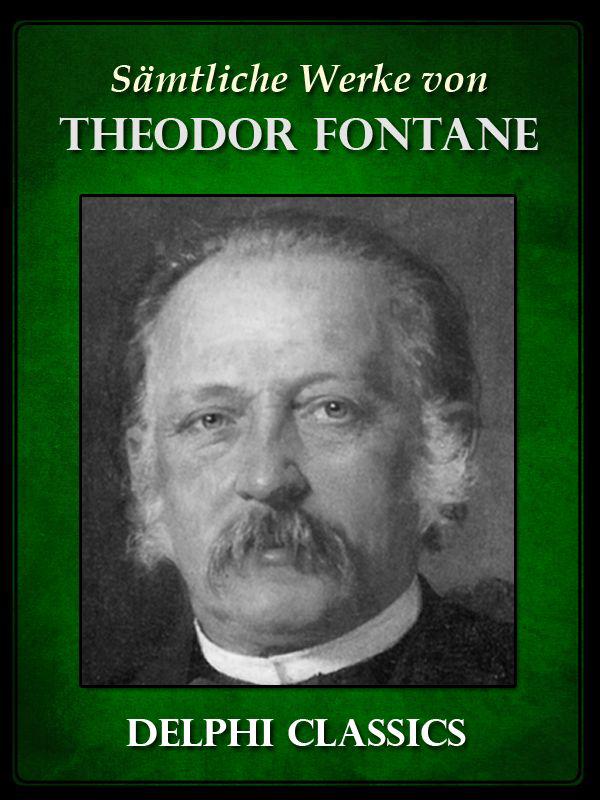![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
aber nicht aus dem Cabinet, sondern aus dem Ministerium, und – ablehnenden Inhalts. »Es sei kein Grund vorhanden, in dem vorliegenden Falle die militärische Verpflichtung aufzuheben.« Unser alter Freiherr war wie niedergeschmettert, und in einem Zustande völligen Außersichseins schrieb er an seine Tochter Alexandrine: »Das mit so vieler Ungeduld von mir erwartete Schreiben empfing ich eben. Es ist leider, statt vom Könige, vom Staatskanzler unterzeichnet. Also so weit sind wir gekommen, daß einen der König nicht mehr einer Antwort würdigt, so weit, daß man die Hardenbergschen Meinungen als königliche Resolutionen annehmen muß. Auf die Gründe meiner Vorstellung ist gar nicht attendieret, sondern nur einfach ausgesprochen worden, daß ein Besitz von Gütern im Clevischen eine solche Befreiung vom Dienst nicht zulasse. Zorn und Ärger über die Behandlungsart, dazu Wehmut über die Auslieferung meines einzigen Sohnes durchkreuzen meinen Kopf, und ich kann Dir nicht sagen, wie sehr ich affiziert bin. Aber eins will ich aussprechen, ich empfinde eine Verachtung gegen den Resolutionsgeber, die mir unauslöschlich in der Seele bleiben wird. In meinem Nächsten meld ich Dir, was für Maßregeln ich zu nehmen gedenke.«
Dieses »Nächste« ließ denn auch nicht lang auf sich warten. Unterm 17. März erfahren wir das Folgende. »Geheimrat Serre
»Sagen Sie, Blumenstein, warum sprachen Sie denn nicht?«
»Ei, der verfluchten Kerlen hatten ja wie ein Pechpflaster auf seinen Maulen. Wollten nich antworten. Schweigen ick auch stille.«
»Wovon sprachen Sie denn?«
»Wovon kann man sprecken mit einem Poet, von seinen Werken hab ick gesprocken.«
»Und das war falsch. Sie mußten von Verwaltungsangelegenheiten mit ihm reden.«
»Ist er so hockmütig? Nach meine Meinungen issen ein großer Poet ein ganz andere Kerlen als ein klein Minister.«
»Und von welchem seiner Werke redeten Sie denn?«
»Ah, das war ein verfluckter Streichen. Wollte Sie vor Tischen noch fragen, was der Kerlen eigentlich hat geschrieben. Und nun sitzen ick da und kann mir partout nix erinnern. Aber zum größten Glücken fallt mir noch ein: › Die Braut von Messina ‹.«
zu Glogau und starb als Major in Dresden. Er ist derselbe, der die Schillerstiftung ins Leben rief. will ein zweites Schriftstück aufsetzen und Sorge tragen, daß es dem Könige direkt zu Händen komme. Karl aber soll nichts davon erfahren; er will begreiflicherweise von keinem Schritte wissen, der sein Ehrgefühl kompromittieren könnte. Was mich angeht, so kann ich meiner Empörung immer noch nicht Herr werden und will es auch nicht. Meine Verachtung gegen den Urheber aber werde ich mit ins Grab nehmen… Von Patriotismus sprechen solche Menschen, die vom Staate leben, immer. Ich habe keine Gelegenheit versäumt, um nützlich zu sein, habe dem Staatsfonds keinen Heller gekostet, nie Vergütigung verlangt, aber auch niemals in die Zeitungen setzen lassen, wenn ich für den Staat den Beutel zog. Und diese elenden Menschen wollen einem alten Manne nicht einen einzigen Sohn freilassen, dessen Freilassung durch vernünftige Gründe als notwendig vorgetragen wird! Bei Gott, es wären Vormünder nötig, die die Schurken fortschafften! Doch genug davon, denn mir wallt das Blut zu sehr, um nicht auszuschweifen. Emprunts forcés und ›gezwungene Freiwillige‹ gehören in die Kategorie des schändlichsten Nonsenses.«
In der ganzen Reihe der Briefe stehen diese beiden einzig da. Nirgends sonst begegnen wir einer ähnlichen Indignation, und leider am unrechten Orte. So wenigstens erscheint es mir. Ein Allerhöchstes stand auf dem Spiel, und die Rücksicht auf den einzelnen mußte hinschwinden neben der Rücksicht auf das Ganze. Daß die Formen unter Umständen etwas artiger und gewählter hätten sein können, mag zugestanden werden. Aber die Dinge lagen so pressant, daß auch zu »Formen«, die meist Zeit kosten, keine Zeit war.
Auch der alte Freiherr, vermut ich, konnte sich gegen Sätze wie diese nicht verschließen, und vielleicht war es gerade das , was ihn über alles Maß hinaus in Leidenschaft und Empörung brachte. Hardenbergs Antwort, so mußt er sich sagen, auch wenn er sich’s nicht sagen wollte , war scharf, aber nicht ungerecht. Es lag nicht an dem Gegner, es lag an ihm selbst, an ihm , der, aus einem egoistischen Gefühl heraus, um etwas gebeten hatte, um das er nicht bitten durfte. Wurd es bewilligt so war es gut, so trat das Mißliche der Bitte zurück,
Weitere Kostenlose Bücher