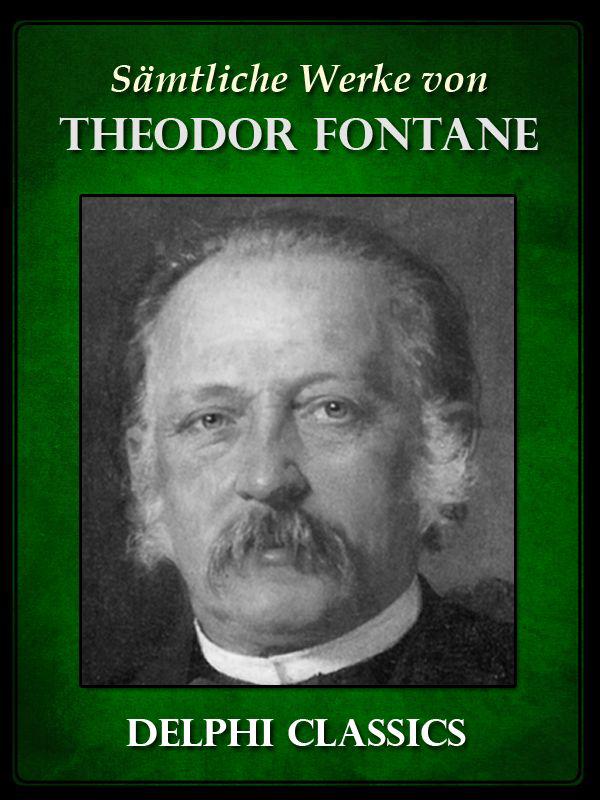![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
10. Oktober 1776,
gestorben 21. September 1811
Er lebte, sang und litt in trüber, schwerer Zeit,
Er suchte hier den Tod und fand Unsterblichkeit .
Die Tochter las die Verse laut, und ob es nun die Nähe des Grabes oder vielleicht auch nur die Verlegenheit war, in die so viele Menschen geraten, wenn sie Verse hören (ein Rest von Respekt vor dem alten Propheten- und Bardentum), gleichviel, alles im Kreise wurde still, und diese Stille wirkte wie Huldigung und Gebet.
Erst der Rattenpinscher, dem die Szene zu lange dauern mochte, gab uns durch einen dreimaligen Unmutsblaff unsren Augenaufschlag und gleich danach auch unsre Bewegung wieder, und denselben Schlängelpfad entlang, auf dem wir gekommen waren, schritten wir nunmehr auf die draußen liegende Waldwiese zurück.
Neben der Tochter ging jetzt ein in dem doppelten Abhängigkeitsverhältnis von Geschäft und Liebe stehender junger Mann und versuchte das auf dem Hinweg unterbrochne literarische Gespräch wieder aufzunehmen. Er begann mit H. von Kleists Käthchen, das alle sonderbarerweise kannten, und gebrauchte dabei den Ausdruck »holdseliges Geschöpf«.
Aber darin versah er es durchaus, und Anna, die das Prinzip der »Erziehung von Anfang an« aller Wahrscheinlichkeit nach von der Mutter adoptiert hatte, replizierte scharf: »Ich weiß nicht, Herr Behm, was Sie so nennen. Ich find es bloß unnatürlich, immer so nachlaufen und sich alles gefallen lassen. Und es verdirbt bloß die Männer, die schon nichts taugen.«
Er wollte mit Nachdruck und Wärme das Gegenteil versichern, aber die Mutter trat peremtorisch dazwischen und sagte: »Recht, mein Anneken… Ja, Herr Behm, Anna hat recht.«
Und nun waren wir wieder an der Stelle, wo der Weg sich teilte, weshalb ich meinen Hut zog und mich aufs artigste verabschiedete. Nichtsdestoweniger konnt ich, rückblickend, an Blick und Gesten unschwer erkennen, daß die Meinungen über mich schwankend und nur die der Mutter zu meinen Gunsten waren. Was mich allerdings über den endlichen Ausgang der Sache beruhigte.
Bald danach, als ich einen höher gelegenen Punkt erreicht hatte, hielt ich noch einmal an und überschaute das vor mir ausgebreitete landschaftliche Bild. Nach Westen hin lagen Fluß und Wald in einem goldnen Abendschimmer, und Villentürme, Kiosks und Kuppeln wuchsen daraus empor. Alles, was ich sah, war Leben, Reichtum, Glück. Und daneben gedacht ich des Dichtergrabes , das einsam ist, trotz der Neugier, die jetzt tagtäglich nach ihm pilgert. Aber ich gedachte zugleich auch der unbekannten Hand, die vor wenig Stunden erst einen Feldblumenstrauß in jenes Häuflein Erde gepflanzt hatte, und getröstete mich: »Eine Hand voll Liebe besiegt jedes Geschick.«
3. Die Kirche zu Stolpe
Stolpe, Stolpeken oder Wendisch-Stolpe scheint – so schreibt Berghaus, dem ich die Verantwortung dafür zuschiebe – das am frühesten in unserer Landesgeschichte genannte Teltow-Dorf zu sein. 1197. Es war eine wendische Besiedlung, auf der sich bis diesen Tag zahlreiche Totenurnen vorfinden. Im übrigen gedeiht hier, und zwar in besonderer Vortrefflichkeit, die Teltower Höhe, nachdem die Bevölkerung jahrhundertelang vorwiegend von Fisch- und Honigfang gelebt hatte. Die Lage des Dorfes ist sehr malerisch, wozu die von Wannsee bis nach Klein-Glienicke sich hinziehende Seenkette das Ihrige beiträgt. Bis zur Reformation gehörte Stolpe zum Brandenburger Bistum, nach welcher Zeit es zum Amte Ziesar und dann zum Amte Potsdam kam. Dahin ward es eingepfarrt, und seine hochgelegene Kirche zeichnete sich, neben andrem, auch durch eine große Glocke aus.
Das ging so bis 1848, wo die große Glocke sprang, und als bald danach die ganze, noch der gotischen Zeit entstammende, zur Zeit des Großen Kurfürsten oder ersten Königs aber umgebaute Kirche baufällig wurde, beschloß man regierungsseitig, alles von Grund aus abzutragen und genau an Stelle der alten Kirche die Fundamente zu einer neuen zu legen. Bei diesen Fundamentierungsarbeiten stieß man auf zwei Grüfte, von denen eine sogleich als Erbbegräbnis der Hofgärtnerfamilie Heydert erkannt wurde, deren Ahnherr, Martin Ludwig Heydert, kurfürstlicher Hofgärtner zu Neu-Glienicke, sich bei Gelegenheit des vorerwähnten, in die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts fallenden Umbaues der Stolper Kirche durch eine reiche Beisteuer von 800 Talern derart wohlverdient gemacht hatte, daß ihm das Recht auf Anlegung einer Familiengruft in besagter Kirche bewilligt wurde.
Weitere Kostenlose Bücher