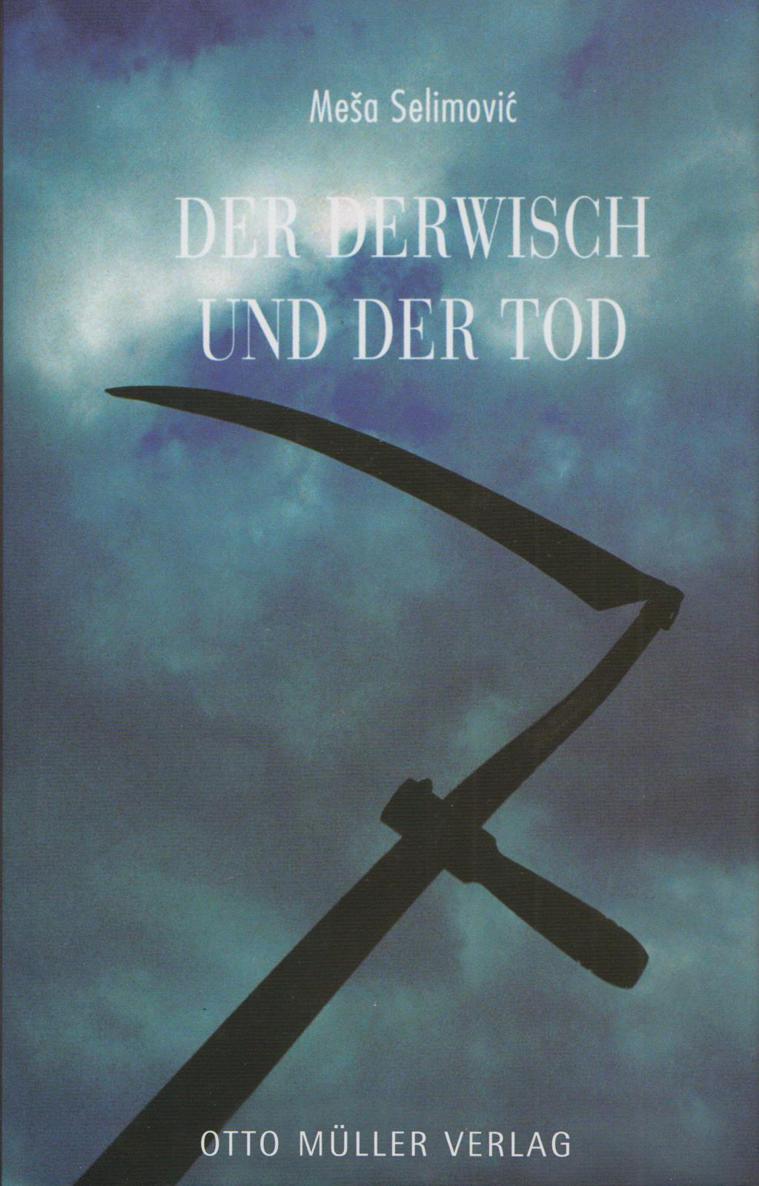![Der Derwisch und der Tod]()
Der Derwisch und der Tod
– die Spannung in mir begann nachzulassen. Sogar
Hunger stellte sich ein, ich wußte nicht, wann ich das letztemal gegessen
hatte. Ich mußte etwas essen, es würde mich kräftigen, würde meine Aufmerksamkeit
ablenken, jetzt aber paßte es nicht, sagte ich mir aufgeheitert, Mustafa war
böse, ich hatte die Kinder vertrieben, und vielleicht hätte ich das nicht tun
sollen. Zwar hatte ich mich nun beruhigt, die Stille tat mir wohl, und wiederum
war mir weh ums Herz. Nur ein wenig, und das war gut so, gut war es überhaupt,
daß mir ein wenig weh ums Herz war, so kehrte ich zu alltäglichen Gedanken, zum
alltäglichen Leben zurück – in dem ist der Mensch immer ein wenig gut, ein
wenig böse, alles mit jenem Maße, das nicht stört, auch wenn wir glauben, es
sei ziemlich ärgerlich, langweilig. Schlimm kann es sein, wenn der Mensch nicht
fühlt, daß die Zeit sich dehnt. Im Krieg ist es nicht langweilig, auch nicht im
Unglück, auch nicht im Schmerz. Wenn man es schwer hat, ist es nicht langweilig.
So gelangte ich zu dem angenehmen
Zustand oberflächlichen Denkens – die Gedanken verkrampften sich nicht, stießen
sich nicht gegenseitig, sondern glitten über die Schale der Dinge, fanden
leichte Lösungen, die nichts lösten. Das war im Grunde kein Nachdenken, sondern
träumendes Spiel der Gedanken, eine wohlige, angenehme Tätigkeit des Gehirns,
und nichts Nützlicheres gab es für mich in diesem Augenblick. Nein, ich hatte
nichts von dem vergessen, was die größte Qual meines Lebens bedeutete, meine
Eingeweide trugen es wie einen Stein, das Blut schleppte es auf seinen langen
Wegen wie Gift, es hockte in den Windungen meines Gehirns wie ein Polyp. Doch
in diesem Augenblick war es zur Ruhe gekommen, wie wenn bei schwerer Krankheit
eine Erleichterung eintritt, daß man meinen könnte, die Krankheit sei
überstanden. Dieses kurzwährende Fehlen der Schwere, diese augenblickliche
Befreiung von der Qual machte es mir – gerade weil es etwas so schnell
Vorübergehendes war und weil alles in mir das wußte – möglich, die Dinge um
mich herum vertraut und schön zu sehen. Meine friedliche Gegenwart in dieser
Eintracht der Natur fühlte ich beinahe als Glück.
Hafiz Muhamed kehrte von einem Weg
zurück, er grüßte und verschwand in seinem Zimmer. Ein guter Mensch, dachte
ich, noch beherrscht von dem Glück meines vorläufigen Abfindens und meines
vereinfachten Denkens, das Leben scheint ungerecht gegen ihn zu sein, aber das
ist nur ein Vorurteil, Leben ist Leben, das eine wie das andere, jeder sucht
Freude, die Nöte kommen von selbst. Seine Freude sind die Bücher, wie es für
andere die Liebe ist, seine Not ist die Krankheit, wie für andere die Armut
oder die Verbannung. Alle gehen wir von einem Ufer zum andern, auf dem schmalen
Seil unseres Lebensweges, und jedem ist ein Ende gesetzt, ohne Unterschied.
Ich erinnerte mich an Verse von
Husein Efendi aus Mostar, und ich sprach sie langsam vor mich hin, mit einer
Befriedigung, die ich vorher nie gefühlt hatte. Ich hörte sie wie gemessenes
Flüstern, ohne Drohung, ohne düsteren Beiklang:
Šahin, der
Seiltänzer, barhaupt und barfuß, tritt aufs
Seil, über das zu wandern ohne Furcht
einzig dem Windhauch gelänge.
Šahin, den
Falken, schrecken nicht die Gefahren, Gottes
Namen nennt er und schreitet hin zwischen zwei Ufern.
Und die
kleinen Falken, seine Schüler, folgen ihm
über die Tiefe.
Drunten
sonnenflimmerndes Wasser, sie hoch
droben, hintereinander, wie Perlen,
aufgereiht auf dünnen Faden.
Tiefer
Abgrund unter ihnen, weiter
Himmel über ihnen.
Sie aber
auf schwankendem Gauklerseile, auf dem
gefährlichen Weg des Lebens.
Gut entsprach es meinem Schicksalsgefühl in
dieser Stunde, das Bild des vereinsamten, aber tapferen Menschen auf dem
schwierigen Lebenspfad. Wäre ich in anderer Stimmung gewesen, so hätte das
Hoffnungslose, das Verurteiltsein zu dem gefährlichen Gang mich erschüttern
können, nun aber erschien es mir als vernünftig und beruhigend, sogar als Bild
des Trotzes. Ich weiß nicht, was der gute Husein Effendi eigentlich meinte, mir
jedenfalls kam es so vor, als verspottete er ein wenig sich selbst und die
anderen.
Hafiz Muhamed trat aus der Tekieh
und stellte sich an das Geländer über dem Fluß. Sein Gesicht war blaß,
aufgewühlt. Er sah mich nicht an. Hatte ihn die Krankheit in der Gewalt?
„Wie fühlst du dich heute?"
„Ich? Weiß nicht. Schlecht."
Ich spürte es, er liebte mich nicht,
doch ich nahm ihm das nicht übel.
Weitere Kostenlose Bücher