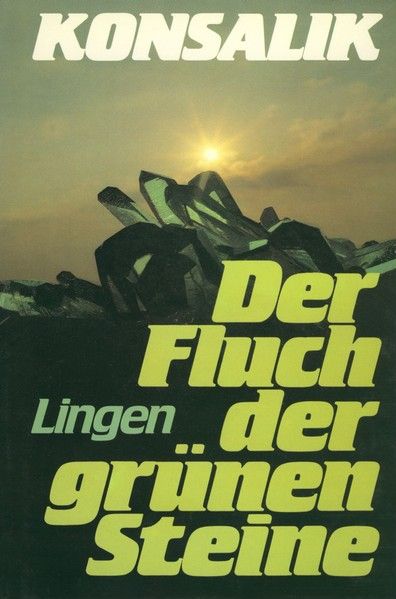![Der Fluch der grünen Steine]()
Der Fluch der grünen Steine
man erkannte, daß es der neue Doktor war, gab man den Weg frei.
Während Pater Cristobal verkündete, jeder könne zu ihm kommen, um sich auszusprechen, denn nichts löse mehr die Qualen der Seele als ein gutes Gespräch, und selbst der Verworfenste sei immer noch ein Kind Gottes, schob sich Dr. Mohr neben Margarita. Sie blickte nicht zur Seite, mit großen leuchtenden Augen hörte sie dem Priester zu. Erst, als Cristobal »Amen« sagte und Miguel mit einem dröhnenden Halleluja einsetzte, in das sofort, sehr zum Ärger Revailas, sowohl Mercedes Ordaz als auch alle Versammelten einfielen, berührte Dr. Mohr leicht Margaritas Arm. Sie zuckte zusammen wie unter einem Schlag, ihr Kopf flog herum, die herrlichen Augen sprühten ein wildes Feuer. Dann, als sie Dr. Mohr erkannte, wandte sie sich wortlos wieder dem Altar zu.
Bis zum Ende des Gottesdienstes standen sie stumm nebeneinander. Erst nach dem Segen, bei dem sie mit gesenktem Haupt niederkniete, und nach dem ›Glockenläuten‹, das dieses Mal Miguel übernahm und die Eisenpfanne bearbeitete, als müsse er sie in Stücke zerhämmern, schob sich ihr Vater zwischen Margarita und Dr. Mohr und blickte den Doktor mißtrauisch an.
»Gehen Sie, Señor!« sagte er rauh. »Sie passen nicht zu uns.«
»Nur, weil ich glattere Hände habe als ihr?« Er warf einen Blick zu Margarita. Nun hatte sich auch die Mutter dazwischen geschoben. Verschlossen, im Gesicht das Leid ihres Lebens, bildete sie mit dem Vater eine Mauer: Laß unsere Tochter in Ruhe. Du gehörst nicht hierher. Und wer nicht aus unserem Stand ist, bringt nur Unglück. Wir kennen sie, die erbarmungslosen Jäger unserer hübschen Töchter.
»Was wollen Sie?« fragte der Vater.
»Ich habe Ihre Tochter im Polizeigefängnis kennengelernt.«
»Sie hat es erzählt!« Der Vater wurde unsicher. Da stand ein feiner Herr und redete ihn mit ›Sie‹ an. Das war nicht nur ungewöhnlich und völlig ungewohnt, das war ein Benehmen, das man nicht einordnen konnte. Ein Guaquero ist eine Handvoll Dreck, das war selbstverständlich. Und nicht anders als Dreck wurde man auch behandelt – bis man mit seinem verknoteten Taschentuch kam und es, den Revolver neben sich auf der Tischplatte, ausbreitete und den Fund mühseliger, die Gesundheit zerfressender Wochen zeigte: kleine, grüne Steine. Dann war man für eine Stunde ein Mensch, wurde höflich behandelt, bekam einen Schnaps spendiert. Sogar Christus Revaila klopfte einem auf die Schulter und nannte den dreckigsten Burschen seinen Camarada. So ist das Leben eben – ein Guaquero ist nur ein Mensch, wenn er die kleinen grünen Sonnen mitbringt. Aber selbst dann wird es niemandem einfallen, ›Sie‹ zu einem zu sagen und so zu tun, als sei er ein feiner Herr.
»Laß uns gehen, Adolfo«, sagte die Mutter.
»Ich fresse Sie nicht.« Dr. Mohr sah sich um. Die Kirche hatte sich so schnell geleert, als wären alle vor der Entdeckung ihrer geheimsten Sehnsüchte geflüchtet. Nur Pater Cristobal lehnte noch am Altar und tat so, als putze er den versilberten Hostienteller mit einem Handtuch.
»Ich bin Pedro Morero.«
»Wir wissen es. Ich bin Adolfo Pebas, das ist meine Frau Maria Dolores und meine Tochter Margarita.«
»Sie haben noch eine Tochter, Señor Pebas?«
Die etwas verbindlicher gewordenen Gesichtszüge versteinerten sich wieder. »Reden wir nicht von ihr, Señor!« sagte Pebas hart. »Wir fallen schon auf. Lassen Sie uns endlich gehen.«
»Ich möchte Ihnen helfen.«
»Wie?! Helfen!« Pebas lachte rauh. »Wenn Sie uns helfen wollen, dann lassen Sie uns in Ruhe. Das ist die beste Hilfe! Vielleicht können Sie mir mal eine Kugel aus dem Körper holen oder meinen Tod feststellen wie bei Pablo Ramirez. Dafür danke ich Ihnen hiermit im voraus … später kann ich's ja nicht mehr.«
Er lachte wieder mit einer galligen Bitterkeit, drehte sich weg, griff seiner Frau und seiner Tochter unter den Arm und verließ mit ihnen die Kirche. Dr. Mohr zögerte. Dann lief er ihnen nach, holte sie draußen auf der Straße ein und ging neben ihnen her.
Die Pebas blickten starr geradeaus, als gäbe es keinen Begleiter. Erst, als sie bei ihren beiden Mauleseln angelangt waren, die an der Schmalseite des Platzes an einen armseligen, verstaubten und vertrockneten Baum gebunden waren, ließ Adolfo Pebas die Arme seiner Frau und seiner Tochter los und vertrat Dr. Mohr den Weg.
»Sie haben Glück, ein leidlich sympathischer Mensch zu sein!« sagte er dumpf. »Jedem anderen, der sich so
Weitere Kostenlose Bücher