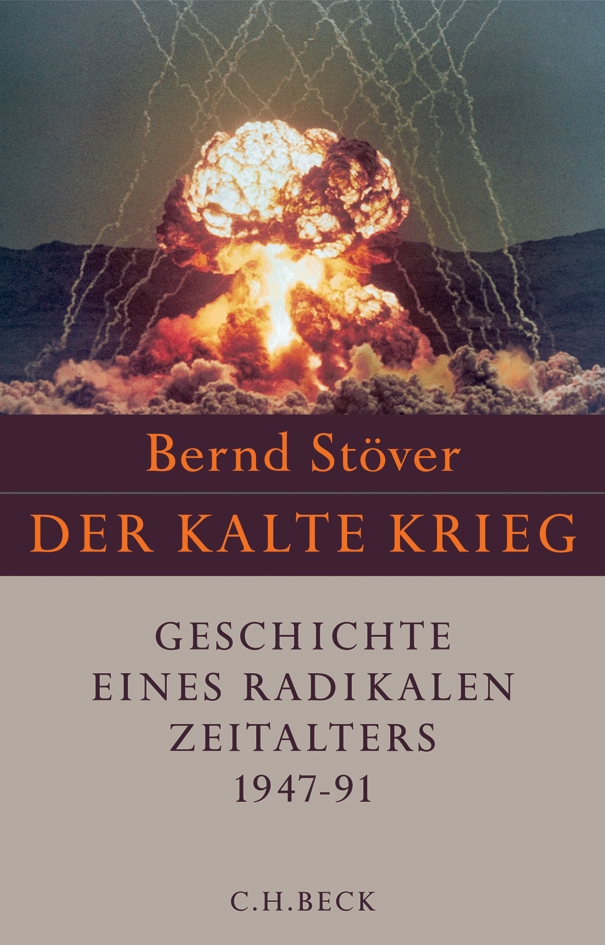![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
Eingriffe der Siegermächte am einschneidendsten. Im Gegensatz zur DDR konnten allerdings in der Bundesrepublik die oktroyierten politischen Maßnahmen bis etwa 1952 als weitgehend abgeschlossen gelten. Nach dem 1945 etablierten Programm zur Umerziehung der Deutschen, dessen harte Linie am deutlichsten der amerikanische Befehl JCS 1067 widerspiegelte, hatten die Westmächte mit dem beginnenden Kalten Krieg eine deutliche Abschwächung ihrer Besatzungspolitik vorgenommen. Der positive Effekt ließ nicht lange auf sich warten. Vor dem Hintergrund einer seit der Weimarer Republik vorhandenen grundsätzlichen Sympathie für «Amerikanisches», das als Inbegriff des «Modernen» galt, wuchsen auch die Erfolge der «Amerikanisierung von unten». Vor allem wurden die «Amerikahäuser» mit ihren Bibliotheken und Kulturveranstaltungen angenommen. 1953 gaben etwa fünfzig Prozent ihrer Besucher auf Nachfrage an, sie hätten durch diese Einrichtungen ihre Meinung über die USA positiv verändert. 4 Darüber hinaus bedeuteten die großzügigen wirtschaftlichen und politischen Hilfen wichtige psychologische Siege. Als 1949 die Nürnberger Spielzeugfirma Arnold das erste militärische Spielzeug nach dem Krieg auf den Markt brachte - einen kleinen US-Jeep vom Typ «Willy» -, wurde es, allen vorherigen Warnungen zum Trotz, ein Verkaufsschlager. Man erklärte sich das damit, daß «der Jeep» wohl die guten Erinnerungen an die Amerikaner symbolisiere. 5 Gemessen an der öffentlichen Akzeptanz, waren die USA auch ansonsten erfolgreicher in der Neugestaltung als die Sowjets. Auf bestimmten Gebieten scheiterten aber auch sie, so an der Reform des traditionellen deutschen Schulsystems nach US-Vorbild. 6
Erfolgreich waren die Amerikanisierung und - mit erheblichem Abstand - auch die Sowjetisierung immer dann, wenn sie im Alltag und damit gleichsam beiläufig aufgenommen wurden. Diese Phase begann nach der «Normalisierung» des Verhältnisses zur Besatzungsmacht, etwa ab Mitte der fünfziger Jahre. Am einflußreichsten oder, wie ihre Kritiker betonten, am anfälligsten erwies sich die Sprache. Lehnübersetzungen nach sowjetischem Vorbild wie Kombinat, Kader, Nomenklatur, Plansoll oder Kulturhaus ersetzten nicht nur offiziell nach und nach die deutschen Bezeichnungen in der DDR, sondern gingen rasch auch in die Umgangssprache ein. 7 In der Bundesrepublik waren seit den fünfziger Jahren verstärkt Amerikanismen wie Job, Comic, Fan, Hobby, Beat oder Pop üblich. Hier wurden Zeitschriften wie der 1946 gegründete Spiegel, für Jugendliche dann insbesondere die seit 1956 erscheinende Bravo, zur wichtigsten Brücke. Anders als in der Bundesrepublik, wo sowjetische Begriffe kaum eine Chance hatten, in die Alltagssprache einzudringen, adaptierten DDR-Bürger nach und nach Amerikanismen, wobei einige neue Lehnwörter wie Broiler oder Dispatcher sogar nur hier verwandt wurden. Allgemein war auf beiden Seiten Deutschlands vieles von dem, was man für besonders fortschrittlich hielt, mit angloamerikani-schen Begriffen belegt. Das wichtigste Einfalltor für die DDR führte aber über die elektronischen Medien, über das Radio und schließlich das Fernsehen. Man kann mit Recht mutmaßen, daß dies der Weg war, über den schließlich das mehrheitliche Votum der Deutschen auf beiden Seiten für die amerikanische «Super-culture» und mit ihr schließlich wohl auch für «den Westen» allgemein fiel. 8 Mit der Musik des «Klassenfeinds» kamen weitere Begriffe: Single, Song, Boogie-Woogie, Blues, Beat, Rock, Pop oder Disco. Trotz anfänglich heftigsten und auch später noch anhaltenden Widerstands der SED, speziell auch Walter Ulbrichts, konnte sich die DDR dieser schleichenden Amerikanisierung nicht entziehen. 9 Noch während seiner Regierungszeit erschien 1965 die erste in DDR-Lizenz produzierte Beatles-Schallplatte. Die von Ulbricht selbst noch Ende der fünfziger Jahre versuchte gezielte Abwehr amerikanischer Rhythmen durch die Einführung des «Lipsi» - einer Art parteitreuen Tanzmusik kam wie andere Versuche dieser Art nicht an. Nachdem 1965, im Anschluß an das berüchtigte «Kahlschlagplenum», für einige Zeit westliche Beat-Mu-sik wieder als «Gift des Klassenfeindes» dem offiziellen Verdikt verfiel, entdeckte die SED in den späten sechziger Jahren sogar amerikanische Musik für ihre Propaganda. Schallplatten der US-Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg von Joan Baez, Pete Seeger oder Bob Dylan konnten mit offiziellem Segen in der DDR
Weitere Kostenlose Bücher