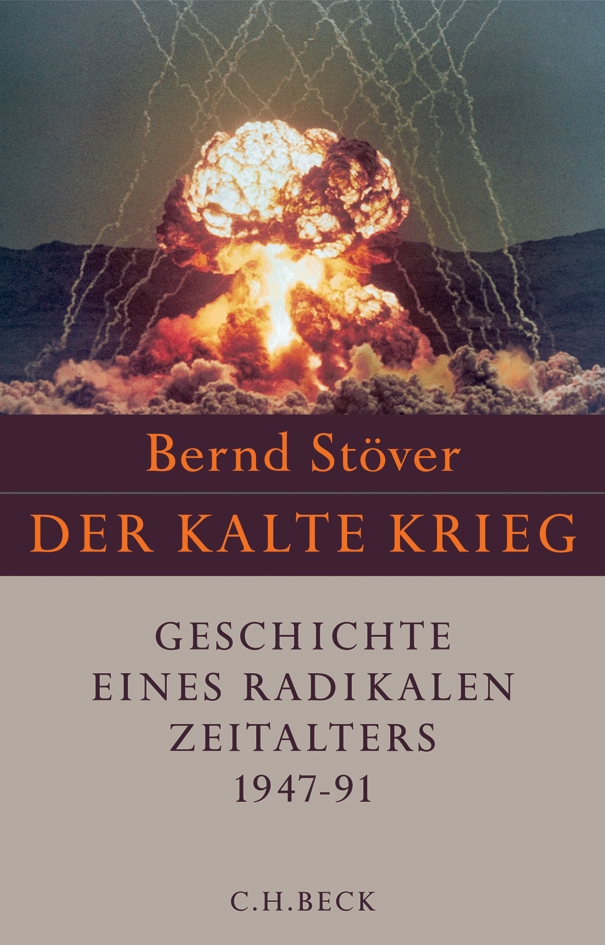![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
ausfiel, je mehr die Hegemonialmacht davon den Bestand ihres «Imperiums» abhängig machte.
Besonders anschaulich lassen sich die Bedingungen, Inhalte und Konsequenzen von Amerikanisierung und Sowjetisierung wiederum am deutsch-deutschen Beispiel demonstrieren. 1 In der SBZ/DDR zeigte sich die direkte Einflußnahme der UdSSR zunächst vor allem beim Umbau ihrer Besatzungszone zu einer «deutschen Volksdemokratie» zwischen 1945 und 1949. Im Jahr ihrer Gründung hatte die DDR bereits, wie auch alle anderen sowjetisch kontrollierten Staaten in Ostmitteleuropa, eine «sowjetische» Verfassung. Die Verstaatlichung von Produktionskapazitäten nach Moskauer Direktiven, die, auf alle Satellitenstaaten hochgerechnet, 1949 bereits bei rund neunzig Prozent lag, zog auch in der DDR weitere, aus der Sowjetunion bekannte politische und wirtschaftlich-soziale Gleichschaltungseffekte nach sich. Als die jeweiligen kommunistischen Parteien in den einzelnen Satellitenstaaten die Sowjetisierung zum Teil in die eigenen Hände nahmen - allerdings weiterhin unter Aufsicht Moskaus -, verschärfte sich dieser Druck sogar noch einmal erheblich. Es gab nicht nur einen vorauseilenden Gehorsam und eine «Selbstgleichschaltung», sondern auch die berüchtigten formellen Übergaben von sowjetischen Befehlen mit unangekündigten Kontrollen, die bis in die Dörfer reichten. Auch wenn mit Beginn der Chruschtschow-Ära 1953 die offizielle sowjetische Einflußnahme zunächst zurückging, griff Moskau im Zweifelsfall nach wie vor ein. Da die gesamte Wirtschaft der RGW-Staa-ten länderspezifisch geordnet war, hatte ein Ausbrechen einzelner Mitglieder immer weitreichende negative Folgen. In der DDR galt der bis 1971 amtierende Parteichef Ulbricht allerdings ohnehin als moskautreu, ebenso wie sein Nachfolger Honecker. Erst als Gorbatschow ab Mitte der achtziger Jahre einen liberaleren Kurs steuerte, konnte sich die SED-Führung nicht mehr mit Moskau arrangieren. Ein prägnantes Beispiel für das Verhalten der SED gegenüber sowjetischen Vorgaben war die Schulpolitik, an der Ulbricht und Honecker gemeinsam beteiligt waren. Hier wurde 1965 das zunächst eher fachspezifisch organisierte nationale Modell in der polytechnischen Ausbildung in dem Moment zugunsten der Ideologievermittlung verändert, als klar wurde, daß die Sowjetunion mehr kommunistische Erziehung wünschte. 2 So war es keine Überraschung, daß zum Beispiel auch die Zwangskollektivierung der DDR-Landwirtschaft seit den fünfziger Jahren rigoros weiterbetrieben wurde, selbst als sich ernste Versorgungsprobleme zeigten und die Flüchtlingsquote nach Westdeutschland in bisher unerreichte Höhen schnellte. Bemerkenswerterweise kritisierten dann selbst sowjetische Berichte vor und nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 die zu harte Linie der DDR-Führung. Sie sei nicht in der Lage, die notwendige Zustimmung für das sowjetische Modell, den Kommunismus und den neuen Staat zu erzeugen. 3
Seit dem Mauerbau 1961, der unter diesen Voraussetzungen zu Recht als das eigentliche Gründungsdatum der DDR bezeichnet worden ist, stabilisierte sich der ostdeutsche Teilstaat, und damit wurden auch die sowjetischen Einflüsse unauffälliger. Dies betraf unter anderem die weitere institutionelle Sowjetisierung, die sich etwa in der Bildung immer größerer «Kombinate», aber auch in der Einführung der sowjetischen Industrienorm zeigte, die von der bisher verwendeten deutschen erheblich abwich. Teilweise führte die Übernahme sowjetischer Entwicklungen - zu den berüchtigtsten gehörte etwa der forcierte Aufbau sogenannter Rinderoffenställe - tatsächlich zu katastrophalen Folgen in der Wirtschaft. Bestimmte politische Rituale blieben der Bevölkerung eher fremd, etwa der von der DDR-Staats- und Parteiführung aus der UdSSR übernommene «Bruderkuß». Andere Politrituale wie die offizielle Maikundgebung, während der Parteiorganisationen, aber auch die NVA an der Staatsführung vorbeizogen, waren als Formensprache zwar bekannt, erinnerten speziell in Deutschland aber in fataler Weise an das vorangegangene Dritte Reich. Bezeichnenderweise waren andere Neuerungen beliebt, wenn sie nicht als Oktroi empfunden wurden. Die Jugendweihe etwa, die Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung aufnahm und damit weniger als sowjetischer Import erkennbar wurde, blieb über das Ende der DDR hinaus attraktiv.
Auch in den Westzonen Deutschlands, der späteren Bundesrepublik, waren die zwischen 1945 und 1949 erfolgenden
Weitere Kostenlose Bücher