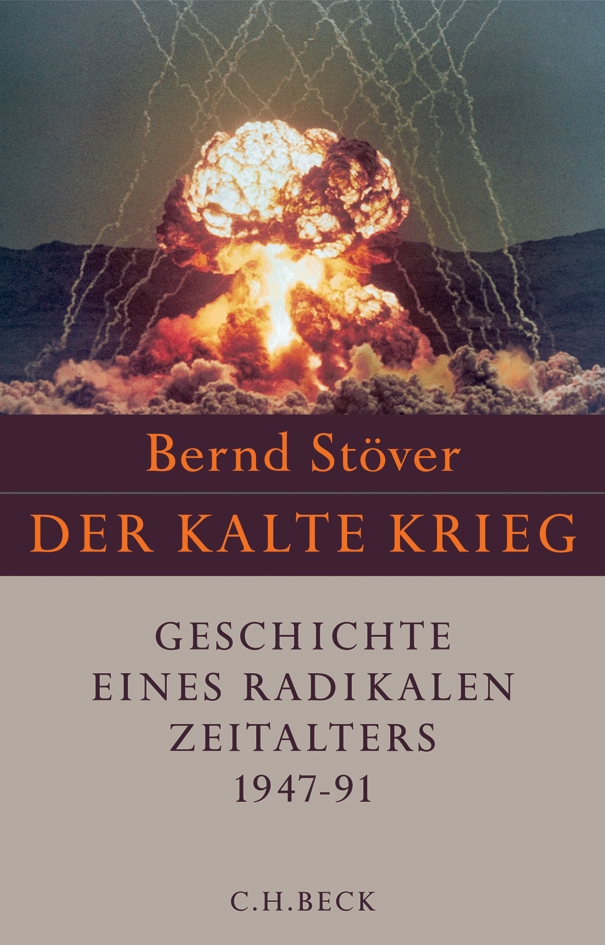![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
weltweit ein Unikum im Kalten Krieg blieb, zu einem zentralen Schaufenster beider Systeme entwickeln. Eine Voraussetzung dafür war, daß die Stadthälften bis zum Mauerbau 1961, trotz verschärfter Kontrollen, für beide Seiten offen blieben. Nach der Abriegelung wurde Ostberlin mit dem Abschluß des Passierscheinabkommens 1963 zunächst wieder für die Westberliner, dann mit den weiteren Vier-Mächte-Abkommen 1970/71 auch wieder für Bürger der Bundesrepublik und schließlich auch für Touristen aus anderen Staaten zugänglich. Wer nicht in den Ostteil reisen wollte oder konnte, hatte bis zur Öffnung der Mauer 1989 die Möglichkeit, auf eigens gebauten Hochständen an der Mauer einen Blick auf die Sperranlagen und die «Hauptstadt der DDR» zu werfen. Aus der entgegengesetzten Richtung blieb Westberlin dagegen zwischen 1961 und dem Mauerfall 1989 für DDR-Bürger größtenteils verschlossen. Eine Ausnahmeregelung gab es unter anderem für Rentner, die später in die Bundesrepublik reisen durften. Die anderen konnten Westberlin und den Westen im Radio oder Fernsehen hören oder sehen; es blieb der Blick vom Fernsehturm in Ostberlin auf den Westteil oder - für eine besonders interessierte und argwöhnisch beobachtete Minderheit - von Zeit zu Zeit das Mithören eines Konzerts, das in Westberlin demonstrativ an der Mauer veranstaltet wurde. Nicht zufällig hatte auch Axel Springer sein 1962 gebautes Verlagshochhaus direkt an der Mauer plaziert. Tatsächlich fürchtete die SED das «Schaufenster Westberlin» auch nach 1961. Selbst U-Bahn-Stationen wurden zu stillgelegten «Geisterbahnhöfen», durch die die Ostberliner Linien ohne Halt hindurchfuhren. Die größte Grenzübergangsstelle an der Friedrichstraße, die auch von den in Westdeutschland oder anderen im Westen lebenden DDR-Besu-chern genutzt werden mußte, wurde nach und nach zu einem subtilen System der offenen und verdeckten Überwachung ausgebaut.
Die ab 1961 immer weiter verstärkte Abschottung Ostberlins von Westberlin war bereits die Bankrotterklärung der DDR gewesen. Zum Ärger der SED wurde sie, trotz vieler Kampagnen, die zum Beispiel mit Hilfe von Spielfilmen den Sinn des «Antifaschistischen Schutzwalls» erklären sollten, von den meisten ihrer Bürger wohl auch so wahrgenommen. Daß dies für den Ostblock und insbesondere für Chruschtschow, der in den Jahren zuvor so vehement den freien Wettbewerb der Systeme angekündigt hatte, nicht die Wunschlösung war, lag auf der Hand. Geplant war die Auseinandersetzung der Systeme an dieser Schnittstelle eigentlich ganz anders. Wie, das machte nicht zuletzt die Stadtplanung sichtbar, die bereits unmittelbar 1945 begonnen hatte. Zwar gingen die Planer noch einige Jahre von der Einheit Berlins aus, doch absehbarerweise konnte keiner dieser Gesamtbebauungspläne («Kollektivpläne») unter den Bedingungen des Kalten Krieges verwirklicht werden. Seit 1950 entwickelten sich die beiden Stadthälften systemspezifisch: der Ostteil zunächst nach Stalins Vorstellungen, über die eine DDR-Delegation im Frühjahr des Jahres in Moskau informiert worden war, der Westteil nach westlichen, vor allem amerikanischen Ideen, die wiederum deutlich von emigrierten Bau-haus-Schülern beeinflußt waren. 56 Zwar setzte Chruschtschow nach Stalins Tod 1953 - nicht zuletzt aus Kostengründen - die allmähliche Abkehr vom aufwendigen neoklassizistischen «Zuckerbäckerstil» seines Vorgängers durch. Aber als wichtigstes Monument sowjetisch-deutscher Architekturvorstellungen im geteilten Berlin konnten zwischen 1952 und 1954 die Wohnbauten an der repräsentativen Stalinallee großteils fertiggestellt werden. Die Straße war der erste und zentrale Teil der «sozialistischen Umgestaltung der Hauptstadt der DDR». Hier entstanden großzügige «Arbeiterwohnungen», die allerdings in der Praxis dann nur «verdienten Parteigenossen» zugänglich blieben und entsprechenden Zorn während des Aufstands vom 17.Juni 1953 auslösten. Die im gleichen Stil geplanten, abschließenden Turmbauten der Stalinallee wurden erst zwischen 1957 und 1960 errichtet. Nicht mehr begonnen wurden dagegen die vielen im sowjetischen Stil geplanten Staats- und Parteibauten der SED, für die unter anderem auch das Berliner Schloß 1950 gesprengt worden war.
Im Westteil Berlins wurden ab 1951 bewußt Wohnungsbauten nahe der Sektorengrenze errichtet. Wie dringend man im Westen einen architektonisch-politischen Gegenentwurf zur Präsentation des kommunistischen
Weitere Kostenlose Bücher