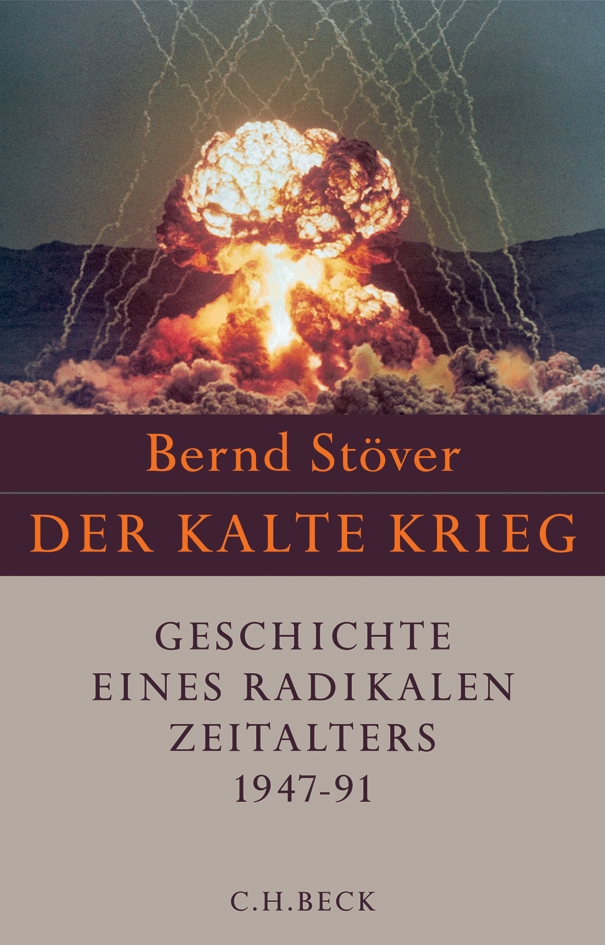![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
Niederschlagung des Prager Frühlings - zu Hochrufen auf den tschechischen Reformer Dub-cek hinreißen ließen. 48
An der innerdeutschen Schnittstelle des Kalten Krieges fiel die Begeisterung für westliche Musik natürlich immer deutlicher auf als in den weiter östlicher gelegenen Ländern des Ostblocks, insbesondere auch in der Sowjetunion. Sie war aber auch dort vorhanden. Schon in den fünfziger Jahren hatte das Chruschtschowsche Tauwetter ab 1956 dazu geführt, daß sich jugendliche Fans westlicher Musik mehr an die Öffentlichkeit wagten. Diese Stiljagi indes, die den Behörden auch durch ihre Vorliebe für westliche Kleidung, durch längere Haare und durch ihr ausdrücldiches Bekenntnis zum Müßiggang auffielen, wurden in den folgenden Jahren konsequent verfolgt. Wie fast überall im Ostblock war jedoch ab Mitte der sechziger Jahre auch in der UdSSR der Siegeszug westlicher Musik nicht mehr aufzuhalten. Die Beatles und die Rolling Stones wurden auch in der UdSSR zu Ikonen der Jugendszene. Paul McCartney revanchierte sich 1989 dafür mit einer exklusiv für die Sowjetunion produzierten Langspielplatte. Allerdings schritt man gegen das Hören westlicher Musik und von «Feindsendern» auch noch in der Sowjetunion der Breschnew-Zeit rigoros ein. Immerhin aber konnte sich die sowjetische Regierung noch kurz vor Breschnews Tod dazu durchringen, 1980 ein offizielles Rockfestival zu genehmigen. Das noch ausschließlich von sowjetischen Gruppen bestrittene «Tbilissi-Festival» in der Hauptstadt Georgiens - darunter die berühmt-berüchtigte Punk-Band Aquarium, die später zum Aushängeschild für die Liberalität der Perestroika wurde - war der Beginn einer vorsichtigen Öffnung. Allerdings war sie nur von kurzer Dauer und wurde unter den beiden Nachfolgern Breschnews, Andropow und Tschernenko, sogleich wieder eingeschränkt. Bis zum Beginn der Ära Gorbatschow wurde für einige Jahre wieder die aus den fünfziger Jahren entliehene These von der Unterwanderung der sozialistischen Staaten durch westliche Musik das offizielle Credo, das mit speziellen Kampagnen gegen Rock- und Pop-Mu-sik unterstrichen wurde. «Unrussisch» sei die westliche Musik, befand 1982 etwa die Zeitschrift Komsomolskaja Prawda. 49 In diesen Jahren fielen sogar die politisch belanglosen «Disco-Filme» aus dem Westen - etwa der 1977 gedrehte Streifen Saturday Night Fever mit John Travolta - dem amtlichen Verbot zum Opfer.
Einen umfassenden Versuch, die Jugendkultur aus der einseitigen Verbindung zum Westen zu lösen, aber auch aktiver für die eigenen politischen Ziele zu nutzen, wagte die DDR noch einmal 1973. Die «X. Weltfestspiele der Jugend» in Ostberlin unter dem Slogan «Für antiimperialistische Solidarität und Frieden» sollten mit dem Auftritt von rund zweihundert einheimischen Bands so etwas wie ein Gegenentwurf zum amerikanischen Woodstock-Festival 1969 und den vielen weiteren Open-Air-Konzerten im Westen zur selben Zeit sein. Das war auch in der DDR-Führung nicht unumstritten. Mißtrauisch gegenüber der «Hippie-Kultur» blieb vor allem das MfS. Die Begeisterung vieler Jugendlicher in der DDR für dieses Lebensgefühl hat vor allem der ostdeutsche Autor Ulrich Plenzdorf in seinem 1972 vorgelegten Theaterstück Die neuen Leiden des jungen W. eindrücklich beschrieben. Ein Jahr später wurde es in der Romanfassung auch in Westdeutschland zum Bestseller. Plenzdorfs Protagonist «Edgar Wibeau», ein der Ödnis einer ostdeutschen Kleinstadt und einem ungeliebten Beruf nach Ostberlin Entronnener, hatte alle Merkmale jugendlicher Opposition: lange Haare, Interesse für Popmusik und er trug vor allem Jeans aus dem Westen. «Ich meine natürlich echte Jeans», ließ Plenzdorf seinen Romanhelden sagen. «Es gibt ja auch einen Haufen Plunder, der bloß so tut wie echte Jeans.» 50 Die Affinität zum westlichen «Klassenfeind» war auch ansonsten unübersehbar, zumal Plenzdorf nicht nur permanent Anglizismen verwendete, sondern sich literarisch eng an ein berühmtes westliches Vorbild hielt: den bereits 1951 erschienenen amerikanischen Jugendroman The Catcher in the Rye von J. D. Salin-ger. Dennoch ist Die neuen Leiden des jungen W. keineswegs eine schlicht antikommunistische, geschweige denn eine einfache Abrechnung mit der DDR, wo das Stück immerhin aufgeführt und regulär als Roman verkauft werden konnte. Das Buch verstand sich eher als eine aufmüpfige Kampfansage an den formalisierten, den «real existierenden» Sozialismus.
Weitere Kostenlose Bücher