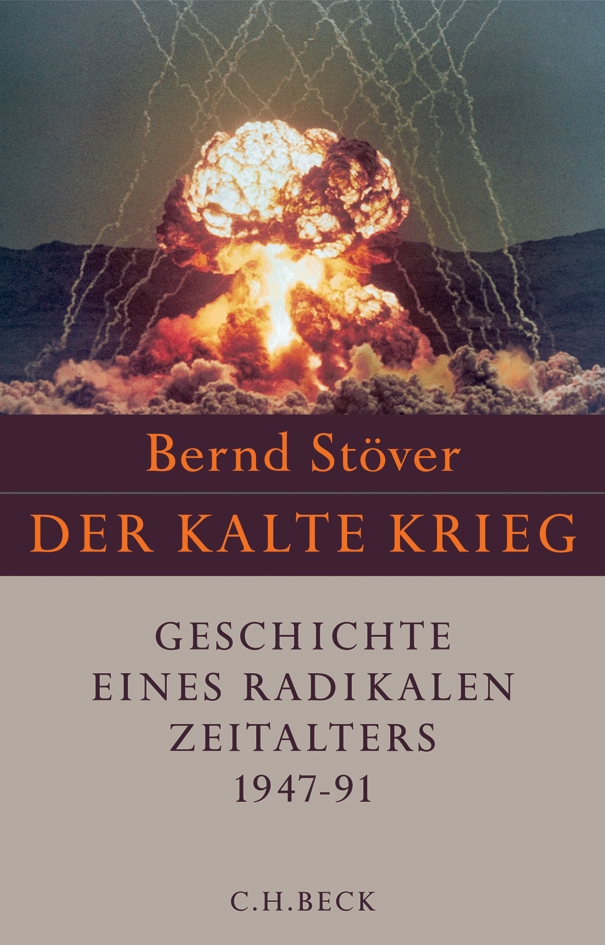![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
politischen Ziel. Sportliche Wettkämpfe gegen westliche Staaten, etwa die Olympischen Spiele, waren in dieser Interpretation nichts anderes als der Wettbewerb der Systeme: Sie waren Klassenkampf. Nicht zuletzt spricht das Rachebedürfnis gegen abtrünnige Sportler für die enorme politische Bedeutung. Zwar wurde der mysteriöse Autounfall von Lutz Eigendorf, einem in den Westen geflohenen Fußballspieler des Berliner FC Dynamo, niemals aufgeklärt, aber es spricht einiges dafür, daß die Staatssicherheit an ihm, dessen Akte den Namen «Verräter» trug, 1983 ein tödliches Exempel statuierte. Wie bei der «Desertion» des berühmten sowjetischen Ballettänzers Rudolf Nurejew, der sich 1961 während eines Gastspiels in Paris in den Westen absetzte, sah man im Ostblock nicht nur das Überlaufen von Geheimnisträgern, sondern auch von Sportlern oder Künstlern als gravierende Niederlage im Kalten Krieg. Auch gegen Nurejew war das KGB damals tätig geworden. Der bereits ausgearbeitete Racheplan, der unter anderem beinhaltete, ihm die Beine zu brechen und ihn damit berufsunfähig zu machen, wurde allerdings nicht mehr ausgeführt. 62
Aber auch aus westlicher Perspektive war Sport im Kalten Krieg häufig Politik. Dies belegte nicht nur der mit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan begründete Boykott des Westens bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980, für den sich die Sowjets vier Jahre später bei den Spielen in Los Angeles revanchierten, an denen sie wiederum nicht teilnahmen. Selbst Schachspiele, wie die berühmte am 11. Juli 1972 veranstaltete prestigeträchtige Partie im isländischen Reykjavik zwischen dem amerikanischen Großmeister Bobby Fischer und dem amtierenden sowjetischen Weltmeister Boris Spassky wurde unter diesen Bedingungen zu einem Duell im Kalten Krieg. 63 Für das Zustandekommen intervenierte US-Außenminister Henry Kissinger sogar persönlich. Nicht zuletzt führte auch im Westen die Überzeugung, daß Sport Politik sei, zum Beginn einer gezielten staatlichen Förderung, um auch auf diesem Feld im Wettkampf der Systeme zu bestehen. 64
Zur weiteren Illustration der Bedeutung des Sports im Kalten Krieg lohnt sich der Blick auf zwei in ihrer politischen Brisanz besonders herausstechende Fußballweltmeisterschaften: in der Schweiz 1954 und in der Bundesrepublik 1974. Obwohl das Endspiel zwischen der Bundesrepublik und Ungarn in Bern auf «neutralem Boden» stattfand, war der politische Zündstoff mit Händen greifbar. Beide Staaten, die im Zweiten Weltkrieg Verbündete gewesen waren und somit zur Verliererffaktion gehörten, aber jetzt den gegnerischen Blöcken im Kalten Krieg zugeordnet waren, verstanden den Sport - und eben auch den Fußball - als Möglichkeit, wieder internationale politische Anerkennung zu sammeln. Für die Bundesrepublik, die bis 1952 bei Wettkämpfen sogar noch ohne eigene Nationalhymne antrat, war es 1950 schon ein Erfolg, daß sie in den Internationalen Fußballverband (FIFA) wiederaufgenommen worden war. Die Politik in Bonn hielt sich sogar ausdrücklich zurück. Deutlicher schöpfte das sowjetisch besetzte Ungarn damals sein Selbstbewußtsein aus dem Sport. Ministerpräsident Imre Nagy formulierte 1954 in einer Parlamentsrede selbstbewußt: «Wir sind eine Sport-Supermacht.» 65 Politisch war das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954 als Ost-West-Duell hoch aufgeladen. Entsprechend gravierende Bedeutung hatte der überraschende 3 :2-Sieg der Westdeutschen, das «Wunder von Bern», das Millionen in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR, am Radio und im Fernsehen miterlebten. Es war vor allem ein enormer Schub für das nationale Selbstbewußtsein nicht nur der Bundesrepublik. Auch in der DDR hatten viele mitgezittert. Umgekehrt traf die Ungarn die unerwartete sportliche Niederlage außergewöhnlich hart, wobei die Mechanismen des Kalten Krieges unmittelbar sichtbar wurden. Die heimkehrenden Spieler sahen sich als «Verräter» gebrandmarkt. Gerüchte kursierten, die besagten, sie hätten sich in Bern mit «2000 Mercedeswagen» bestechen lassen, um den sicheren Sieg zu vergeben. 65 Bei anschließenden Krawallen mußten die Spieler sogar vor der wütenden Menge geschützt werden. Die Debatte um die Niederlage und angebliche Bestechungen «durch die Kapitalisten» wurden danach vor allem in den Medien weiter ausgefochten. Intern hatte die Niederlage für einige ungarische Spieler sogar noch dramatischere Folgen. Außer einer Untersuchungskommission der
Weitere Kostenlose Bücher