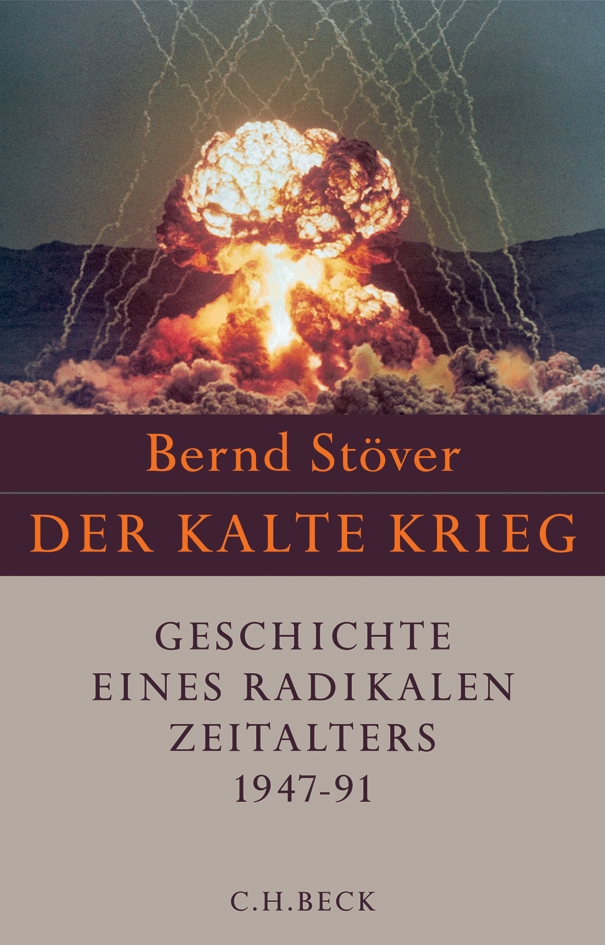![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
Als sich der 66jährige Mönch Thich Quang Duc am 11. Juni 1963 auf einer belebten Kreuzung in Saigon aus Protest selbst verbrannte und das Photo unter anderem von der amerikanischen Zeitschrift LIFE weltweit verbreitet wurde, blieb Washington nichts anderes übrig, als Diem fallen zu lassen. Dessen Nachfolger, General Nguyen Khänh, lockerte dann einige der antibuddhistischen Bestimmungen.
Während im Westen einige Religionen als Verbündete galten, setzte die Sowjetunion im Kalten Krieg konsequent auf die Verfolgung oder zumindest die Überwachung aller Konfessionen. Dies schloß nicht aus, daß zum Beispiel in den letzten Jahren der Stalin-Ara die Russisch-Orthodoxe Kirche als patriotische Kraft galt. Generell befürchtete der Kreml aber bis zum Ende des Kalten Krieges, daß sich die Religionen zum Spaltpilz der Sowjetunion entwickeln könnten, und tatsächlich setzten die westlichen Strategien im Kalten Krieg zeitweilig gezielt darauf. Je nach Landesteil konnten nach Auffassung des Kreml, das Christentum, der Islam oder auch der Buddhismus (Lamaismus) als politischer Gegner verdächtig sein. So wurde in der UdSSR schon bis 1957 dem Lamaismus - unter anderem durch Deportationen - die Grundlage entzogen. Entscheidender aber wurde die Verfolgung des Islam und des Christentums. Da neunzig Prozent der Muslime in der Sowjetunion Sunniten waren, wurden die politischen Probleme in angrenzenden Ländern, so etwa im ebenfalls mehrheitlich sunnitischen Afghanistan, immer auch als Problem für die Sicherheit der UdSSR begriffen. 72 Der Einmarsch 1979 war daher auch der Versuch des Kreml, die angrenzenden Sowjetrepubliken vor der Berührung mit den sunnitischen Paschtunen und dem radikalen Islamismus zu bewahren.
Der größten Verfolgung in der Sowjetunion und ihren ostmitteleuropäischen Blockstaaten blieben allerdings die christlichen Kirchen ausgesetzt. 1946 wurde in der UdSSR die Katholische Kirche durch Zwangsvereinigung mit der Russisch-Orthodoxen Kirche aufgelöst. Die protestantischen Kirchen wurden vor allem unter Chruschtschow weiter zurückgedrängt und zum Teil zu illegalen Organisationen erklärt. In den ostmitteleuropäischen Satellitenstaaten Moskaus wurden mit Beginn des Kalten Krieges vor allem auch prominente Kirchenführer Opfer politischer Verfolgung. In Ungarn verurteilte man den dortigen Primas der Katholischen Kirche, Kardinal Jözsef Mindszenty, schon 1949 wegen angeblichen Hochverrats zu lebenslanger Haft. Während des Volksaufstands 1956 befreit, konnte er bis 1971 nur im Asyl der US-Botschaft in Budapest überleben und starb schließlich 1975 im Wiener Exil. Besonders scharfer Verfolgung waren die Kirchen in Albanien nach 1967 ausgesetzt. Aber auch in Polen blieb die Katholische Kirche bis in das letzte Jahrzehnt des Kalten Krieges Objekt scharfer staatlicher Repression. Die Entführung und Ermordung des Warschauer Vikars Jerzy Popieluszko durch die Staatssicherheit 1984 war dafür ein zentrales Beispiel. Popieluszko hatte in seinen Predigten die Verhängung des Kriegsrechts und die Verfolgung der Gewerkschaft Solidarnosc immer wieder angeprangert. Besonders massiver Verfolgung waren auch die Kirchen in China, insbesondere in den Jahren der Kulturrevolution, ausgesetzt.
Dennoch wäre es falsch, die christlichen Kirchen, etwa in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten, ausschließlich als Opfer zu betrachten. Der Versuch, kirchliche Arbeit in der Diktatur zu erhalten, war in vielen Fällen erfolgreich, führte aber auch zur politischen Anpassung und zum Teil sogar zur fügsamen Kooperation mit staatlichen Stellen. In der UdSSR veröffentlichte das
Patriarchat der Russisch-Orthodoxen Kirche 1950 zum Beispiel eine scharfe Verurteilung der amerikanischen Intervention in Korea, um seine politische Nähe zu Stalin zu unterstreichen. 73 In Deutschland war es vor allem die bis 1969 noch als Einheit betrachtete Evangelische Kirche (EKD), die trotz der Teilung deutschdeutsche Kontakte aufrechterhalten konnte. 74 Die Beziehungen hoher Kirchenfunktionäre zu den Staatssicherheitsbehörden führten vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges zu heftigen Debatten. Im Weltkirchenrat, der ohnehin wegen seines Appeasement gegenüber dem Kommunismus in heftiger Kritik stand, war seit 1969 ein eigener KGB-Agent («Kusnezow») plaziert, in der DDR warb das MfS verschiedene Inoffizielle Mitarbeiter an, die regelmäßig über Interna Auskunft gaben. Die Konferenz lutherischer Kirchen in Europa, die Ende 1992 im
Weitere Kostenlose Bücher