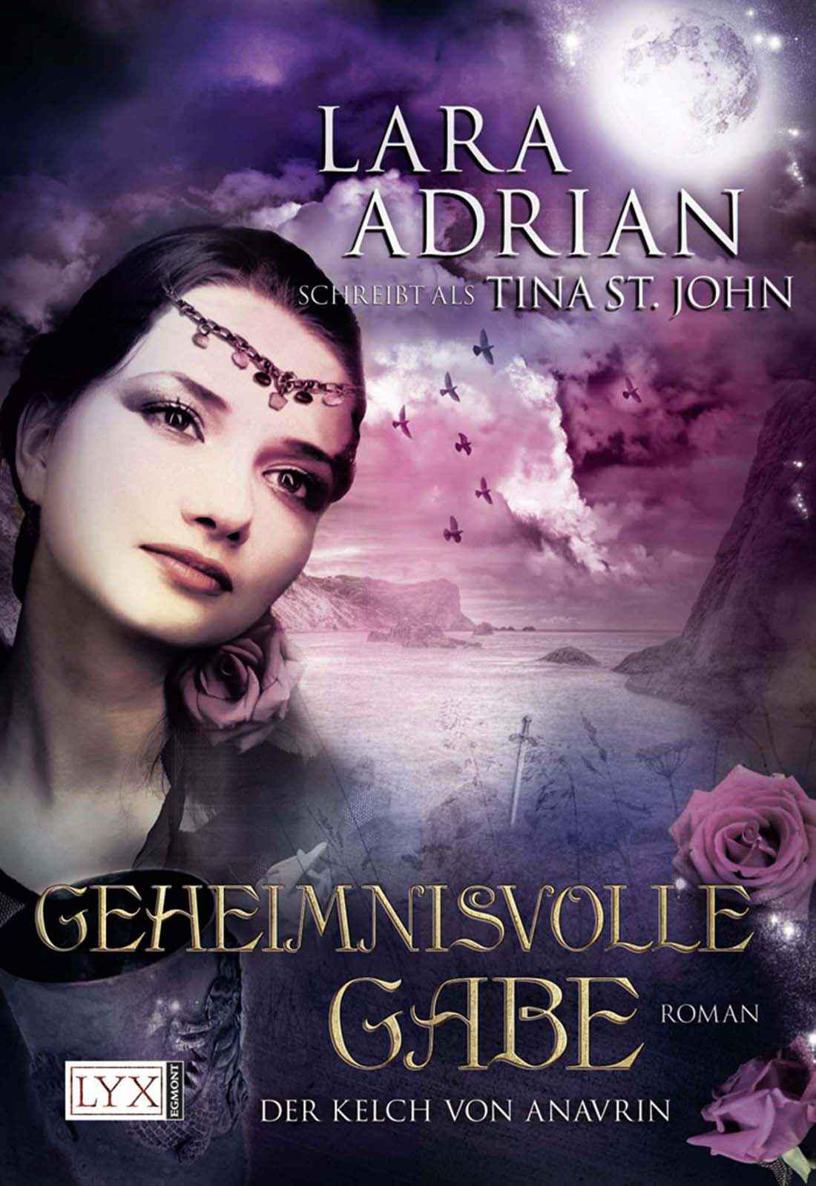![Der Kelch von Anavrin: Geheimnisvolle Gabe (German Edition)]()
Der Kelch von Anavrin: Geheimnisvolle Gabe (German Edition)
Calandra zum Trocknen vor dem Feuer ausgebreitet hatte. Randwulf, der Eindringling, war nirgendwo zu sehen. Zögernd hieß sie das Gefühl von Frieden willkommen, als sie sah, dass der Fremde die Behausung verlassen hatte.
Vorsichtig erhob sich Serena von dem Lager, auf dem ihre Mutter friedlich schlummerte, und schlich zum Fenster der Hütte. Mit der behandschuhten Linken drückte sie die Fensterläden gerade so weit auf, dass sie die kleine Lichtung überblicken konnte. Angestrengt spähte sie in das Halbdunkel des anbrechenden Tages und suchte nach Bewegungen zwischen den Bäumen oder auf dem Waldpfad. Nichts. Hatte sie eben noch angespannt die Luft angehalten, so atmete sie nun erleichtert aus.
War der Fremde etwa nur in ihrem Traum vorgekommen? Sie wagte kaum zu hoffen, dass er fort war, aber allein die Tatsache, dass er nun nirgends zu sehen war, ließ ihr Herz vor Freude hüpfen.
Ihr Umhang hing an einem Haken an der Wand. Serena griff danach, legte sich den warmen Wollstoff um die Schultern und verknotete rasch die Schleifen am Hals. Sie durchquerte den Raum und nahm den Wassereimer, der neben der Feuerstelle stand. Erleichtert, ihrer morgendlichen Arbeit ungestört nachgehen zu können, hielt sie auf die Tür zu. Der unwillkommene und anmaßende Gast schien tatsächlich fort zu sein.
Den Henkel des leeren Eimers in der Armbeuge, trat Serena ins Freie. Kaum spürte sie die kühle Erde des schmalen Waldpfads unter ihren bloßen Füßen, da hörte sie, dass ihr jemand vom Strand her im Dämmerlicht entgegenkam. Es waren schwere, zielgerichtete Schritte, die von Zorn und düsteren Gedanken zeugten. Sie zögerte, ahnte sie doch, wer dort vom Küstenstreifen kam, aber sie wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte. Schließlich machte sie auf dem Absatz kehrt und war schon im Begriff, wieder in die Hütte zu gehen.
»Serena«, hörte sie seine Stimme. »Du bist früh auf.«
Als sie nichts darauf erwiderte und mit fest zusammengekniffenen Augen reglos vor der Hütte stand – in der Hoffnung, der Fremde möge nur in ihrer Einbildung existieren – , kam Rand näher. Schließlich stand er hinter ihr, so nah, dass er seine Hand auf ihre Schulter hätte legen können, um Serena zu sich zu drehen. Doch sie kam ihm zuvor und wandte sich um, wich aber gleichzeitig gut zwei Schritte zurück, um ihm nicht zu nah zu sein.
»Ich dachte, Ihr wärt fort«, sprach sie.
»Hast du das nur gedacht oder auch gehofft?«
Serena schluckte und blickte dem Fremden in die Augen. Forschend glitt sein undurchdringlicher Blick über ihr Gesicht. »Sowohl als auch.«
Ihrer Antwort begegnete er mit einer hochgezogenen Braue, sagte aber nichts. Im trüben Licht der Dämmerung wirkten seine Züge weniger hart als im Schein des nächtlichen Herdfeuers, als Licht und Schatten über die scharfen Konturen seines Gesichts gehuscht waren. Die bärtige Kinnpartie jedoch sah immer noch angespannt aus, und auch sein Mund, der eine dünne Linie bildete, hatte nichts von seiner Düsterkeit verloren. Er blickte auf den Eimer, den Serena umklammert hielt, ehe er sie fragend ansah.
»Ich war gerade auf dem Weg zum Brunnen, um Wasser zu holen«, erklärte sie und beantwortete damit die Frage, die er ihr gewiss im nächsten Augenblick gestellt hätte.
»Und deine Mutter?«
»Sie schläft noch.«
Als müsse er Serenas Aussage überprüfen, schaute er zur Hütte hinüber, die in der Stille der kleinen Lichtung stand. »Also gut«, sagte er nach einer kurzen Pause. »Dann hol das Wasser. Du kannst mir gleich den Weg zum Brunnen zeigen.«
Serena sog die Luft ein und war kurz davor, sich der Aufforderung zu widersetzen, doch sie hielt sich zurück. Sie wollte sich auf keine Auseinandersetzung mit diesem gefährlichen Mann einlassen, denn sein stechender Blick sagte ihr, dass er ein Nein nicht hinnehmen würde. Mit ausgestrecktem Arm wies er sie an, den Weg in den Wald einzuschlagen. Serena kam der stummen Aufforderung nach. Sie ging auf dem schmalen Pfad voraus, die schweren Schritte des Fremden im Ohr. Auch er trug kein Schuhwerk, aber während sie stets behutsam auftrat und auf jede zarte Blume achtgab, die in den Weg hing, zertrat Rand die Pflanzen unbekümmert.
Seine forschen Schritte und sein gebieterisches Gehabe ärgerten sie. In seiner anmaßenden Art schien er der Ansicht zu sein, er könne über sie bestimmen und den Wald für sich beanspruchen. In nur wenigen Stunden war er in ihre friedvolle Welt eingedrungen und hatte alles
Weitere Kostenlose Bücher