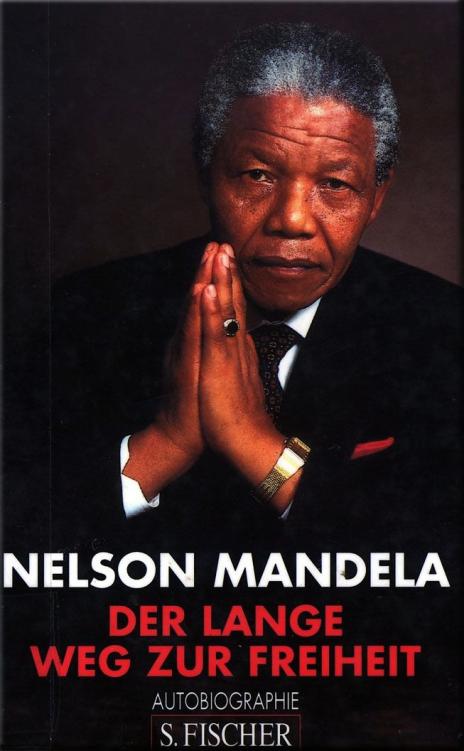![Der lange Weg zur Freiheit]()
Der lange Weg zur Freiheit
von General Willemse besucht, der mir mitteilte, ich würde am nächsten Tag zu Präsident Botha gebracht. Er beschrieb den Besuch als »Höflichkeitsbesuch«, und ich sollte um halb sechs Uhr morgens abfahrbereit sein. Ich sagte dem General, ich freue mich zwar auf das Treffen, halte es aber für angebracht, zum Besuch bei Mr. Botha einen angemessenen Anzug und eine Krawatte zu tragen. (Den Anzug vom Besuch der Gruppe der hervorragenden Persönlichkeiten gab es schon lange nicht mehr.) Der General willigte ein, und kurz darauf erschien ein Schneider, um meine Maße zu nehmen. Am gleichen Nachmittag wurden mir ein neuer Anzug, Krawatte, Hemd und Schuhe geliefert. Ehe er ging, fragte der General noch nach meiner Blutgruppe, nur für den Fall, daß am folgenden Tag irgend etwas geschehen sollte.
Ich bereitete mich auf das Treffen vor, so gut ich konnte. Ich sah noch einmal mein Memo und die umfangreichen Notizen durch, die ich dafür angefertigt hatte. Ich überflog so viele Zeitungen und Veröffentlichungen, wie ich konnte, um sicher zu sein, daß ich auf dem laufenden war. Nach Präsident Bothas Rücktritt als Führer der National Party war an seiner Stelle F. W. de Klerk gewählt worden, und es hieß, zwischen den beiden Männern gebe es beträchtliche Rivalitäten. Manche würden Bothas Bereitschaft, mich zu treffen, vielleicht als Mittel ansehen, seinem Rivalen die Schau zu stehlen, doch das betraf mich nicht. Ich probte die Argumente, die der Staatspräsident möglicherweise vortragen würde, sowie meine Antworten darauf. Bei jeder Begegnung mit einem Gegner muß man dafür sorgen, daß man genau den Eindruck vermittelt, den man vermitteln will.
Der Besuch bei Mr. Botha versetzte mich in Spannung. Er war als »die Groot Krokodil« – »das Große Krokodil« – bekannt, und ich hatte viele Erzählungen über sein aufbrausendes Temperament gehört. Mir kam er vor wie der Inbegriff des altmodischen, steifnackigen, starrsinnigen Afrikanders, der mit schwarzen Führern nicht diskutierte, sondern ihnen eher diktierte. Der kürzlich erlittene Schlaganfall hatte diese Tendenz anscheinend nur verstärkt. Ich beschloß, falls er sich mir gegenüber auf diese herablassende Weise betragen würde, würde ich ihm mitteilen, daß ich ein solches Verhalten unannehmbar fände, aufstehen und das Treffen abbrechen.
Pünktlich um halb sechs Uhr morgens erschien Major Marais, der Kommandant von Victor Verster, in meinem Haus. Er kam in den Wohnraum, wo ich mich zur Inspektion in meinem neuen Anzug vor ihm aufstellte. Er ging um mich herum und schüttelte dann verneinend den Kopf.
»Nein, Mandela, Ihre Krawatte«, sagte er. Im Gefängnis hatte man nicht viel Verwendung für Krawatten, und an diesem Morgen, als ich sie umlegte, war mir klargeworden, daß ich vergessen hatte, wie man sie richtig bindet. Ich knotete sie, so gut ich konnte, und hoffte, keiner werde es bemerken. Major Marais knöpfte meinen Kragen auf, lockerte die Krawatte, zog sie heraus, stellte sich dann hinter mich und band sie mit einem doppelten Windsorknoten. Dann trat er zurück, um sein Werk zu bewundern. »Viel besser«, sagte er.
Wir fuhren von Victor Verster nach Pollsmoor zur Residenz von General Willemse, wo die Gattin des Generals uns ein Frühstück servierte. Nach dem Frühstück fuhren wir in einem kleinen Konvoi nach Tuynhuys, dem offiziellen Präsidentenbüro, und parkten in einer Tiefgarage, wo man uns nicht sehen würde. Tuynhuys ist ein hübsches Gebäude im Cape-Dutch-Stil des neunzehnten Jahrhunderts, aber an diesem Tag hatte ich keine Gelegenheit, es mir richtig anzusehen. Ich wurde förmlich in die Präsidentensuite hineingeschmuggelt.
Wir nahmen einen Lift ins Erdgeschoß und kamen in eine große, holzgetäfelte Halle vor dem Präsidentenbüro. Dort trafen wir auf Kobie Coetsee und Niel Barnard und ein Gefolge von Gefängnisbeamten. Ich hatte sowohl mit Coetsee als auch mit Dr. Barnard eingehend über dieses Treffen gesprochen, und sie hatten mir immer geraten, dem Präsidenten gegenüber kontroverse Themen zu vermeiden. Während wir warteten, schaute Dr. Barnard zu Boden und merkte, daß meine Schnürsenkel nicht richtig gebunden waren. Rasch kniete er nieder und korrigierte das für mich. Ich merkte, wie nervös die Anwesenden waren, und das machte mich nicht eben ruhiger. Dann öffnete sich die Tür, und ich trat ein, auf das Schlimmste gefaßt.
Von der entgegengesetzten Seite seines feudalen Büros aus kam P. W. Botha auf mich zu.
Weitere Kostenlose Bücher