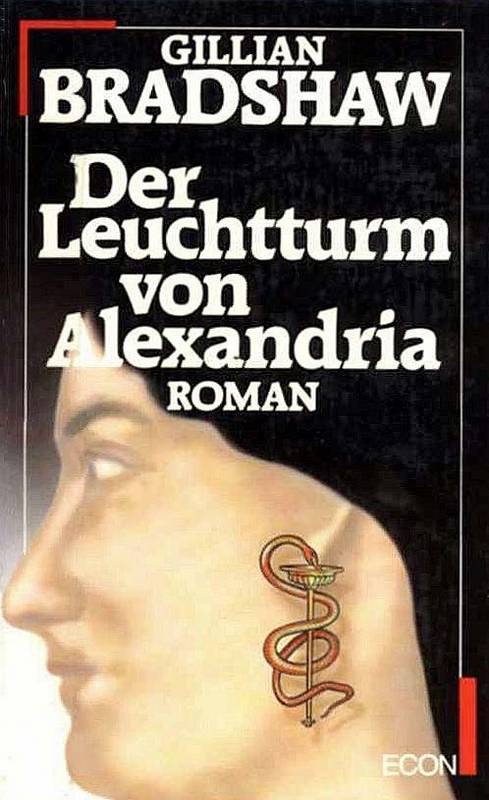![Der Leuchtturm von Alexandria]()
Der Leuchtturm von Alexandria
schön – sehr hübsch und zart jedenfalls.«
»Das stimmt«, meinte Athanaric. »Ja, ich glaube, ich habe an eine Frau wie sie gedacht.«
»Was hält dein Vater davon?« fragte Sebastianus. »Als ich ihn das letztemal gesehen habe, wollte er dich unbedingt mit einer reichen römischen Erbin verheiraten.«
»Daraus ist nichts geworden«, erwiderte Athanaric ohne besonderes Interesse. »Es stimmt, mein Vater möchte mich mit einer Römerin verheiraten. Aber es muß ja schließlich auch römische Mädchen geben, die nicht die ganze Zeit auf den Fußboden starren.«
Sebastianus schüttelte zweifelnd den Kopf. »Ich glaube, sie werden von klein auf dazu erzogen.« Dann sah er mich mit einem Ausdruck des Bedauerns an. »Es tut mir leid«, sagte er.
»Es war taktlos von mir, in Anwesenheit eines Eunuchen von Heirat zu reden.«
»Es macht mir nichts aus«, erwiderte ich. »Außerdem klingt die Sache bei euch ja nicht gerade sehr verlockend.« Ich erhob mich und streckte mich. Es war spät, und ich war müde. »Ich werde euch ein Liebesgedicht zitieren: ›Der Mond ging dahin, die Plejaden sind fort; Mitternacht ist vorbei, bald zieht die Dämmerung herauf.‹«
Sebastianus lachte. »Und du mußt ganz allein zu Bett gehen!«
»Nun, mit deiner Erlaubnis, vortrefflicher Sebastianus, würde ich mich morgen gerne auf den Rückweg nach Novidunum machen. Ich habe mit den Ärzten des Heerführers Maximus gesprochen, und ich sehe keinen Grund, noch länger hierzubleiben. Um die Wahrheit zu sagen, ich finde diese Stadt, abgesehen von der augenblicklichen Gesellschaft, recht unangenehm.«
»Ich auch«, räumte Athanaric ein. »Ich hatte vor, Frithigern die Anweisungen von Lupicinus zu überbringen. Wir können ein Stück des Weges gemeinsam reiten.«
»Sehr gut«, meinte Sebastianus. »Aber schleppe ihn bitte nicht mit dir mit, um irgendwelche Goten zu behandeln.«
Athanaric warf ihm einen gereizten Blick zu. »Warum denn nicht?«
»Weil Frithigern einen Aufstand plant. Ich möchte nicht, daß er meinen Chefarzt entführt. Wenn es zum Krieg kommt, möchte ich, daß Chariton Römer behandelt und nicht Goten.«
»Es gibt wahrscheinlich gar keinen Krieg«, protestierte Athanaric. »Und die Terwingen könnten gut einen Arzt gebrauchen.«
»Dann soll Lupicinus sich darum kümmern. Ich weiß nicht, warum er das nicht tut; es liegt in seinem eigenen Interesse, die Gesundheit der Goten zu erhalten. Ich werde es morgen mit ihm besprechen. Ich bleibe noch etwas; da ich schon einmal in Marcianopolis bin, kann ich mit dem Feldherrn ebensogut noch andere Dinge besprechen. Daphne kann mir Gesellschaft leisten.«
»Sei nicht so unausstehlich«, fuhr Athanaric ihn an. »Gute Nacht.«
Athanaric begleitete mich bis zur ersten Poststation hinter Marcianopolis. Er war immer noch verärgert, daß Sebastianus es ihm verboten hatte, mich zu den Goten mitzunehmen. »Du wärst doch mitgekommen, oder?« fragte er mich.
Ich nickte. In Skythien wartete nicht allzuviel Arbeit auf mich, und ich war sicher, daß die Terwingen in Mösien dringend medizinische Hilfe benötigten. Die Vorstellung, Frithigern könnte mich festhalten, schien mir ganz einfach lächerlich, und das sagte ich auch.
»Genau«, sagte Athanaric. »Ich glaube nicht, daß es jetzt zu einem Krieg kommt, es sei denn, Lupicinus begeht irgendwelche außergewöhnlichen Grausamkeiten. Außerdem bist du Frithigerns Gastfreund und deshalb gegen jede Gewalttätigkeit gefeit. Die Goten nehmen Gastfreundschaft viel ernster als die Römer. Aber Sebastianus glaubt, jeder verhalte sich so wie ein römischer Befehlshaber.«
»Ich dachte, du bewunderst römische Befehlshaber.«
»Oh, es ist mehr an Rom als die paar Lupicini des Kaiserreichs! Es ist mehr an Rom als je an irgendeinem gotischen Königreich dran sein wird. Aber es stimmt, daß die Goten redlicher sind.« Er ritt ein paar Minuten lang schweigend neben mir her, dann runzelte er die Stirn und fragte mich plötzlich: »Wie ist diese Geschichte mit Theodoros’ Schwester denn nun wirklich gewesen?«
»Warum willst du das wissen?« fragte ich.
»Reine Neugier. Irgend etwas stimmt nicht daran; ich habe so ein Gefühl. Irgend etwas ist mir entgangen, was mir hätte auffallen müssen. Etwas, was auf der Hand liegt. Willst du mir nicht auf die Sprünge helfen?«
»Um ehrlich zu sein, ich finde, daß die Sache dich nichts angeht. Es ist, jedenfalls kein Landesverrat im Spiel oder etwas anderes dergleichen, nichts, was den Staat
Weitere Kostenlose Bücher