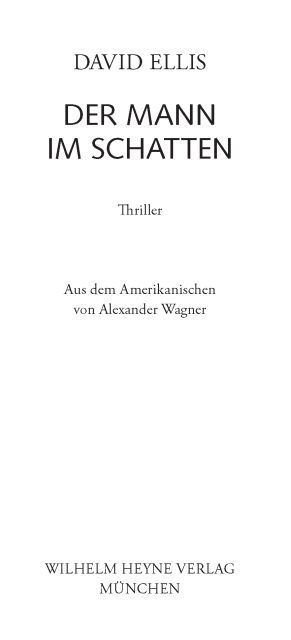![Der Mann im Schatten - Thriller]()
Der Mann im Schatten - Thriller
Plastikgriff der Einkaufstüte.
»Keine Angst«, erwiderte er langsam. »Ich hab’s nicht vergessen.«
Ein Jahr später Oktober 2007
4
Der Mann rief eine Stunde vorher an, um sich einen Termin geben zu lassen, und stellte sich als Mr Smith vor. Am Telefon verriet er meiner Assistentin nichts über den Grund seines Besuchs, außer dass es um eine Rechtsangelegenheit ging, wodurch er sich in nichts von anderen Klienten unterschied, die meine Kanzlei aufsuchten.
Doch von dem Moment an, in dem Marie ihn in mein Büro führte, wirkte er fehl am Platz. Dabei machte er äußerlich eindeutig mehr her als die meisten meiner Mandanten. Er war schlank, trug einen eleganten italienischen Wollanzug, eine exakt gebundene blaue Seidenkrawatte, und sein graues Haar war makellos frisiert. Es war klar, was auch immer er von mir wollte, er war offensichtlich in der Lage, das entsprechende Kleingeld dafür lockerzumachen. So weit, so gut.
Trotzdem - fehl am Platz. Seine Hand war feucht, als ich sie schüttelte, und er vermied jeden Augenkontakt. Während ich mich wieder hinter meinem Schreibtisch niederließ, schloss er unaufgefordert die Bürotür. Es war nicht weiter ungewöhnlich, dass ein Klient mit seinem Anwalt ungestört reden wollte, aber immerhin handelte es sich um mein Büro und nicht um seines. Eine eigenmächtige Geste, eine kleine Machtdemonstration.
»Mr Smith«, begann ich und fragte mich, ob das wohl sein richtiger Name war. Vermutlich ging es um eine Strafsache,
und ich versuche immer gerne zu erraten, um welche Art Vergehen es sich handelt, bevor der Mandant damit herausrückt. Bei einem gelackten Typen wie diesem tippte ich entweder auf Finanzverbrechen oder auf Pädophilie. Im letzteren Fall würde es ein sehr kurzes Gespräch werden.
Smith war offenbar wenig beeindruckt von meiner Büroeinrichtung. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte ein paar Diplome an die Wand genagelt, außerdem ein paar Bilder, die ich günstig bei einer Haushaltsauflösung ersteigert hatte. In den wenigen Regalen fanden sich juristische Fachbücher, in die ich so gut wie nie einen Blick warf. Mein Bruder hatte mir eine Couch geschenkt, die jetzt an der Rückwand des Büros stand, wobei ich allerdings den Eindruck nicht loswurde, dass sie den Raum hoffnungslos überfüllt wirken ließ.
In dieser Umgebung kam mir Mr Smith mit seinem Tausend-Dollar-Anzug vor wie ein an Land geworfener Fisch. In der Brusttasche trug er eines dieser Einstecktücher, das farblich auf die Krawatte abgestimmt war. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Einstecktuch besessen. Ich hasse Einstecktücher wie die Pest.
»Wir möchten gerne Ihre Dienste in Anspruch nehmen, Mr Kolarich. Könnten Sie mich bitte über Ihr Stundenhonorar in Kenntnis setzen?«
In meiner Eigenschaft als selbstständiger Anwalt vertrete ich üblicherweise drei Kategorien von Mandanten. Bei Klienten der Kategorie eins und bei kleineren Delikten, wie etwa Alkohol am Steuer, erhebe ich eine Pauschalgebühr. Kategorie zwei bezahlt mich stundenweise, außerdem verlange ich einen entsprechenden Vorschuss. Kategorie drei schließlich sind Klienten, die großspurig Zahlungen ankündigen, von denen ich dann nie einen Cent zu Gesicht bekomme.
Mein Stundenhonorar beläuft sich für gewöhnlich auf hundertfünfzig Dollar. Aber von Zeit zu Zeit beschließe ich, dass es Zeit für eine Gehaltsaufbesserung ist. Insbesondere wenn mein Mandant ein Einstecktuch trägt.
»Dreihundert«, erwiderte ich. Ein ziemlich gutes Gefühl, das laut auszusprechen.
Smith wirkte amüsiert. Aber wohlerzogen, wie er war - oder sich zumindest gab -, verkniff er sich jeden Kommentar. Ich berechnete ihm einen kräftigen Aufschlag, und er gab mir zu verstehen, dass ihm das sehr wohl bewusst war.
Normalerweise brauche ich etwa eine halbe Stunde, um eine gründliche Antipathie gegen jemanden zu entwickeln, aber dieser Kerl drückte den Zeitrahmen beträchtlich.
»Dreihundert die Stunde ist durchaus akzeptabel«, befand er.
Anderseits, vielleicht urteilte ich doch etwas vorschnell über ihn.
»Sie sind sehr jung«, fuhr er fort. »Ich meine, für einen Fall wie diesen.«
»Mozart hat seine erste Symphonie schon mit zehn komponiert.«
»Verstehe.« Allerdings hatte ich nicht das Gefühl, für Smith in derselben Liga zu spielen wie das Wunderkind Amadeus.
»Sie haben sich an mich gewandt, nicht umgekehrt«, erinnerte ich ihn.
Er überging diese Bemerkung, aber es war ihm deutlich anzumerken, dass er nicht ganz
Weitere Kostenlose Bücher