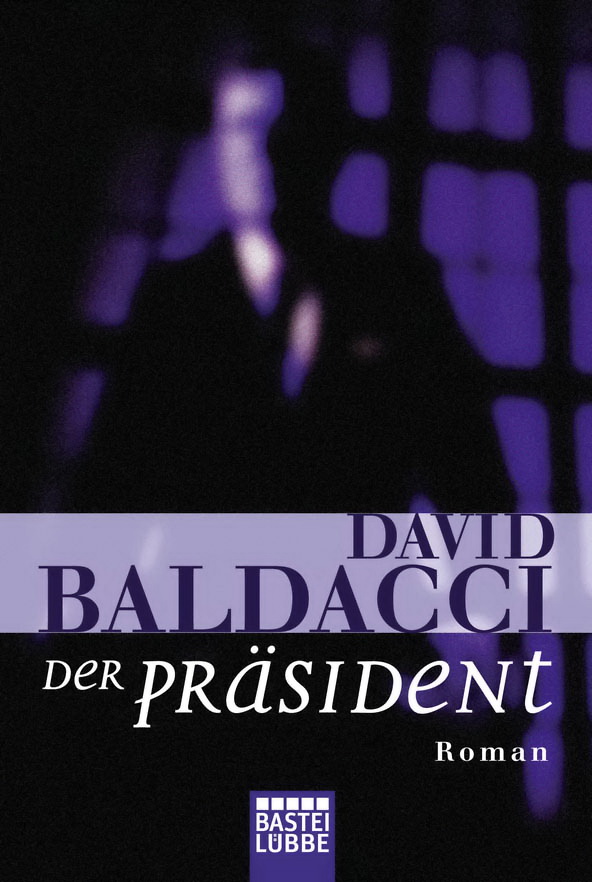![Der Präsident]()
Der Präsident
mehr.
Nach einem Leben voll harter Arbeit, in dem Geld stets Mangelware war, griff Wanda nach ihrem Glückstreffer. Genauso, wie Christy Sullivan es getan hatte. Keine der beiden hatte erkannt, wie hoch der Preis für solche Dinge tatsächlich war.
Luther war nach Barbados geflogen und hätte Wanda dort eine Nachricht zukommen lassen, wäre sie nicht bereits abgereist gewesen. So sandte er den Brief an ihre Mutter. Gewiss hatte Edwina ihn ihr gezeigt. Doch hatte sie ihm geglaubt? Christine Sullivans Leben war der Preis gewesen. Der Preis für Wandas Gier und Sehnsucht nach Dingen, auf die sie kein Recht hatte; so hätte Wanda es empfunden. Luther konnte sich gut vorstellen, welche Gedanken seine Freundin bewegt hatten, als sie allein an die einsame Stelle hinausfuhr, den Deckel von dem Tablettenglas schraubte und in den Schlaf ohne Erwachen sank.
Und er hatte nicht einmal dem Begräbnis beiwohnen können. Ebenso wenig konnte er Edwina Broome mitteilen, wie leid es ihm tat, ohne dabei zu riskieren, sie in seinen Albtraum hineinzuziehen. Edwina stand er genauso nahe wie früher Wanda, in mancher Hinsicht vielleicht noch näher. Zahlreiche Nächte hatten Edwina und er erfolglos versucht, Wanda von ihrem Vorhaben abzubringen. Erst als klar wurde, dass Wanda es mit oder ohne Luther getan hätte, bat Edwina Broome Luther, sich um ihre Tochter zu kümmern, sie nicht wieder ins Gefängnis wandern zu lassen.
Schließlich wandte er die Aufmerksamkeit den Privatanzeigen in der Zeitung zu. Nach wenigen Sekunden fand er, wonach er suchte. Kein Lächeln trat in sein Gesicht, als er die Anzeige las. Wie Bill Burton war Luther, wenn auch aus anderen Gründen, der Ansicht, dass Gloria Russell über keinerlei positive Eigenschaften verfügte.
Hoffentlich nahmen sie an, ihm ginge es nur um Geld. Er holte ein Blatt Papier hervor und begann zu schreiben.
»Überprüfen Sie das Konto.« Burton saß der Stabschefin in ihrem Büro gegenüber. Er nippte an einer Cola Light, sehnte sich aber nach etwas Stärkerem.
»Ich bin schon dabei, Burton.« Russell steckte sich den Ohrring wieder an und legte den Telefonhörer zurück auf die Gabel.
Collin saß schweigend in einer Ecke. Die Stabschefin hatte bisher noch keine Notiz von seiner Anwesenheit genommen, obwohl er gemeinsam mit Burton ins Zimmer gekommen war. Collin nahm nicht an, dass sich daran etwas ändern würde.
»Wann will er noch mal das Geld?« Burton sah sie an.
»Wenn nicht bis Geschäftsschluss eine Überweisung auf dem angegebenen Konto eingeht, hat keiner von uns eine Zukunft.« Sie ließ den Blick zu Collin wandern, dann zurück zu Burton.
»Scheiße.« Burton stand auf.
Finster blickte Russell ihn an. »Ich dachte, Sie wollten sich darum kümmern, Burton?«
Er ignorierte den Blick. »Wie soll die Übergabe verlaufen?«
»Sobald er das Geld erhalten hat, teilt er uns mit, wo wir den Gegenstand finden.«
»Also müssen wir ihm vertrauen?«
»Sieht ganz so aus.«
»Woher weiß er überhaupt, dass Sie den Brief schon bekommen haben?« Burton begann, im Zimmer auf und ab zu laufen.
»Er lag heute Morgen im Briefkasten. Die Post wird aber erst nachmittags zugestellt.«
Burton ließ sich in einen Stuhl fallen. »Im Briefkasten! Sie meinen, er war bei Ihrem Haus?«
»Ich bezweifle, dass er für diese besondere Mitteilung einen Überbringer gewählt hätte.«
»Wieso wussten Sie, dass Sie in den Briefkasten sehen mussten?«
»Die Flagge war oben.« Beinahe musste Russell lächeln.
»Der Kerl hat wirklich Nerven, Chefin, das muss man ihm lassen.«
»Anscheinend bessere als Sie beide.« Sie verlieh der Bemerkung Nachdruck, indem sie Collin eine volle Minute lang anstarrte. Er wand sich unter ihrem Blick und schlug schließlich die Augen nieder.
Innerlich grinste Burton über den Blickwechsel. Es war gut so; in ein paar Wochen würde ihm der Junge dafür dankbar sein, dass er ihn aus dem Netz dieser schwarzen Witwe gerettet hatte.
»Mich überrascht gar nichts, Chefin. Nicht mehr. Wie steht’s mit Ihnen?« Er sah erst sie, dann Collin an.
Russell überging die Anspielung. »Wenn wir das Geld nicht überweisen, müssen wir damit rechnen, dass er bald an die Öffentlichkeit geht. Was wollen Sie dagegen tun?«
Das kühle Gebaren der Stabschefin war nicht gespielt. Sie war zu dem Schluss gekommen, dass sie genug geweint hatte und dass sie es satt hatte, sich ständig übergeben zu müssen. Sie war so verletzt und bloßgestellt worden, dass es ihr bis ans Lebensende
Weitere Kostenlose Bücher