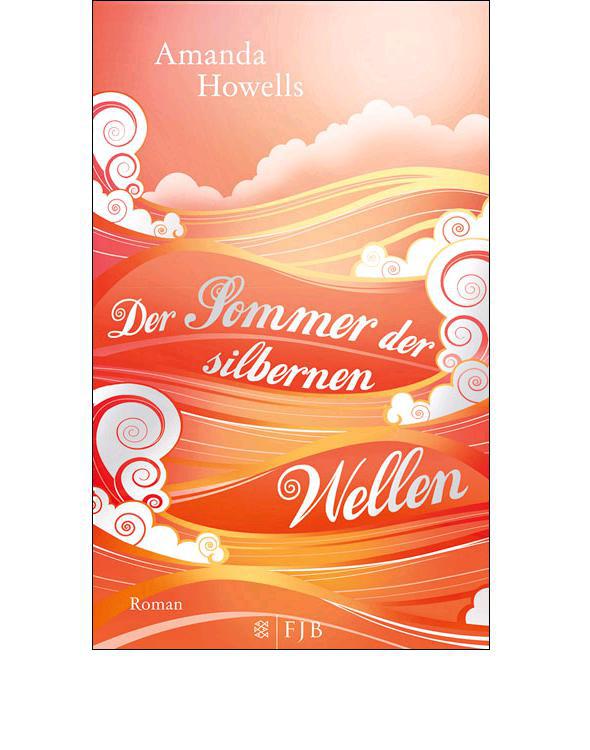![Der Sommer der silbernen Wellen: Roman (German Edition)]()
Der Sommer der silbernen Wellen: Roman (German Edition)
hergewandert war und Corinne und die anderen gerufen hatte, ging ich zurück zum Haus. Drinnen wummerte die Musik wie Kopfschmerzen, man hörte Lachen und klirrendes Glas. Jemand rief »Shit!«, gefolgt von Kichern.
Ernüchtert lehnte ich mich gegen das Geländer der hinteren Veranda und blickte hinaus aufs Meer. Mein Schwips war verflogen. Ich kam mir nur noch idiotisch vor. Mein Kleid war absolut unpassend. Und ich wollte tatsächlich Gras rauchen? Lächerlich. Ich konnte nicht mal so tun, als wäre ich cool genug, so offensichtlich war ich es nicht.
Ich war nur ein ›nettes‹ Mädchen. Ein langweiliges nettes Mädchen, mit dem sich kein vernünftiger Mensch abgeben mochte. Am schlimmsten war, dass ich es den anderen nicht einmal verübeln konnte, denn im Moment hätte ich mich nicht mal mit mir selbst abgeben wollen. Ich begriff allmählich, warum Jake sich nach anderen umgesehen hatte.
Als ich hinaus aufs Meer blickte, sah ich nicht weit draußen die Lichter eines vorbeifahrenden Bootes und stellte mir vor, welche Aussicht sich den Passagieren bot. Vielleicht konnten sie mich erkennen, und dazu die flackernden Lichter, vielleicht trieb die Musik übers Wasser, untermalt von den Geräuschen von Wind und Wasser. Auf die Leute im Boot mochte die Szene in Wind Song zauberhaft, ja, romantisch wirken. Doch von meinem Standpunkt aus war sie alles andere als das.
»Na, wälzt du tiefsinnige Gedanken?«
Ein hochgewachsener Typ lehnte an der Wand hinter mir. Die Silhouette seines Gesichts hob sich vor dem Schein einer altmodischen Gaslampe ab, die von einem Dachbalken hing.
»Nicht wirklich«, erwiderte ich und wünschte, er würde einfach weggehen, wer immer er sein mochte. Ich hatte nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft. Ich hatte mich bemüht, gesellig zu sein, aber es hatte nicht funktioniert. Vielleicht war es auch eher so, dass die Gesellschaft kein Bedürfnis nach mir hatte. Das war doch eigentlich sonnenklar, seitdem Jake mich abserviert hatte – und auch dieser Typ würde mich zweifellos fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, sobald ihm etwas Besseres über den Weg liefe.
»Dein Charleston-Outfit ist wirklich atemberaubend«, sagte der Junge, ohne sich von seiner Position an der Wand wegzubewegen. »Ich bin hin und weg!«
»Charleston-Outfit?«
»Ich dachte, gerade du müsstest wissen, wovon ich rede«, erwiderte er. »Du siehst in diesem Kleid wie ein Mädchen aus den wilden zwanziger Jahren aus, meine Liebe.«
»Aus den zwanziger Jahren?« Ich wusste immer noch nicht, wovon er redete. Machte er sich lustig über mich?
»Streng doch mal deine Phantasie an!«, forderte der Fremde mich beharrlich auf. »Die Umgebung passt perfekt. Wir sind draußen in den Hamptons, dem Spielplatz der Reichen. Wir stehen auf der Veranda eines alten Sommerhauses mit Blick auf das Meer. Du in einem perlenbesetzten Kleid, und ich seh auch nicht schlecht aus – zwar ein bisschen mehr Hipster als Zwanziger, aber es haut hin. Die Musik ist allerdings etwas unpassend, zugegeben«, fügte er hinzu, als ein lauter Hip-Hop-Beat loshämmerte. »Aber alles andere?« Er breitete die Arme weit aus und ging auf mich zu. »Hundertprozentig Gatsby-like!«
»Redest du immer so?«, fragte ich, als der Fremde näher rückte. Er trug ein schmalgeschnittenes Vintage-Jackett und dazu glänzende, zweifarbige Schnürschuhe.
»Ich kann auch still sein, wenn dir das lieber ist.«
Er sah gut aus, stellte ich fest: dünn, aber es passte zu ihm. Sein Gesicht wäre einem zwar nicht quer durch einen ganzen Raum aufgefallen, aber man sah es sich gern aus der Nähe an. Seine Nase war ein wenig gebogen, und er lächelte offen, aber wie unter einer gewissen Spannung, als läge ihm ein Scherz auf den Lippen. Und er hatte eine ungewöhnliche Stimme, sehr tief und ein wenig heiser. »Soll ich lieber nichts sagen? Ich kann nämlich auch der starke, schweigsame Typ sein, weißt du. Ich kann den Mund halten, wenn du …«
»Ja? kannst du das wirklich?«, fragte ich demonstrativ.
Das brachte ihn zum Schweigen. Für kurze Zeit jedenfalls. Ich hatte den ›Großen Gatsby‹ in der Schule gelesen, in der achten Klasse: eine traurige Geschichte über unglückliche Leute in schicken Häusern, die versuchten, sich gegenseitig zu beeindrucken.
»Ich bin übrigens Simon Ross«, sagte er nach einer Weile. »Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass du mir vorhin schon aufgefallen bist. Schon allein durch dein Kleid. Ansonsten scheint hier ja niemand
Weitere Kostenlose Bücher