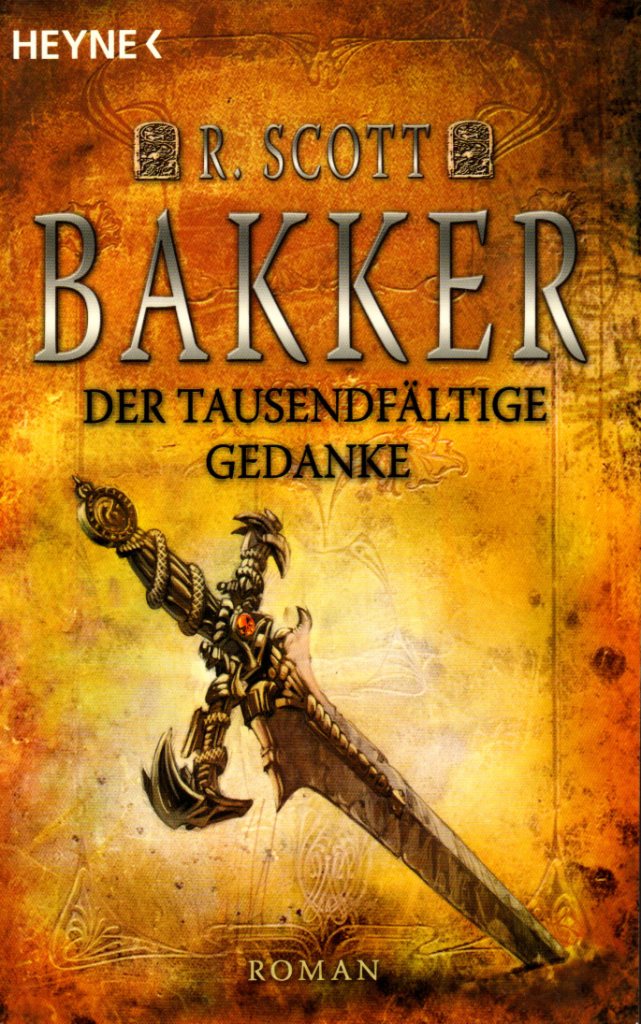![Der tausendfältige Gedanke]()
Der tausendfältige Gedanke
Dûnyain entfernte einfach die Eigensinnigen aus seiner Herde.
Bemüht, im Gedränge an Ort und Stelle zu bleiben, ließ Proyas den Blick einmal mehr über die wimmelnde Menge schweifen, um den Scylvendi zu entdecken. Eben erst hatte der Kriegerprophet sich unter donnerndem Beifall zurückgezogen. Nun sprachen die Herren des Heiligen Kriegs miteinander und tauschten heitere oder empörte Ausrufe aus. Es gab viel zu bereden: die aufgedeckte Verschwörung des Hauses Ikurei, den Ausschluss der Nansur-Truppen vom Heiligen Krieg, die Erniedrigung, ja Entwürdigung des Oberbefehlshabers.
»Ich wette, der kaiserliche Lendenschurz muss gewechselt werden!«, rief Gaidekki aus einer in der Nähe stehenden Gruppe von Adligen aus Conriya. Gelächter dröhnte durch das überfüllte Vorzimmer – schonungslos und aus vollem Herzen, aber nicht ohne einen Unterton von Sorge. Die triumphierenden Blicke, die lautstarken Erklärungen und die lebhaften Gesten und Beteuerungen zeugten davon, wie frisch ihre Bekehrung war. Aber da war noch etwas anderes, das Proyas auch über sein Gesicht geistern spürte: Angst.
Vielleicht war das zu erwarten gewesen. Wie Ajencis gern feststellte, beherrschte Gewohnheit die Seele des Menschen. Solange die Vergangenheit die Gegenwart bestimmte, konnte man sich auf Gewohnheiten verlassen. Doch die Vergangenheit war gestürzt worden, und die Männer des Stoßzahns sahen sich unvorbereitet Meinungen und Annahmen gegenüber, denen sie nicht länger trauen konnten. Sie hatten erfahren, dass die Metapher ein zweischneidiges Schwert war: Um wiedergeboren zu werden, musste man den ermorden, der man war.
Verglichen mit dem, was sie gewonnen hatten, schien dieser Preis lächerlich klein zu sein.
Da der Scylvendi nicht zu sehen war, teilte Proyas die Gesichter der Anwesenden danach ein, ob sie Kellhus verurteilt hatten oder nicht. Viele – Ingiaban beispielsweise – standen reglos, mit vor Reue weit aufgerissenen Augen und kummervoll verkniffenen Lippen da. Andere dagegen – Athjeäri etwa – redeten mit dem ungeminderten Wagemut der Gerechten. Während er sie beobachtete, spürte Proyas, wie Neid an ihm zehrte und ihn dazu zwang, den Blick zu senken und wegzuschauen. Noch nie hatte ihm das Bedürfnis, etwas ungeschehen zu machen, so zugesetzt. Nicht einmal bei Achamian…
Was hatte er damals nur gedacht? Wie hatte es geschehen können, dass er – ein Mann, der alles darangesetzt hatte, sein Herz zu frommer Idealform zu schmieden – beinahe Gottes Stimme ermordet hätte?
Dieser Gedanke regte ihn noch immer auf und ließ vor Scham Übelkeit in ihm aufsteigen.
Selbst die rauschhafteste Überzeugung machte Unwahres nicht wahr. Das war eine bittere Lehre – bitterer noch dadurch, dass sie so erstaunlich deutlich zutage getreten war. Trotz der Ermahnungen von Königen, Generälen und endlosen Balladen war der Glaube bis in den Tod nicht viel wert. Schließlich warfen sich die Fanim ebenso bereitwillig den Speeren ihrer Feinde entgegen wie die Inrithi. Jemand musste getäuscht worden sein. Was gewährleistete also, dass dieser Jemand immer ein anderer war? Was konnte im Licht der offenkundigen Schwäche der Menschen und der langen Kette von Täuschungen, die ihre Geschichte ausmachten, unsinniger sein, als für sich zu beanspruchen, der am wenigsten Getäuschte oder gar der in die Erkenntnis Eingeweihte zu sein?
Und diese offenkundige Einbildung zur Grundlage von Verdammung und Mord zu machen…
Nie hatte Proyas so geweint wie zu Füßen des Kriegerpropheten, denn er, der jede Habgier gegeißelt hatte, hatte sich als der Habgierigste erwiesen. Er hatte nichts stärker begehrt als die Wahrheit, und weil die Wahrheit sich ihm entzogen hatte, hatte er sich an seinen Glauben gehalten. Und wie hätte es anders sein können, da er sich ein Leben lang vor ihm erniedrigt und er ihm dafür den Luxus des Richtens gewährt hatte?
Da sie mithin so sehr zu ihm selbst geworden waren?
Das Versprechen der Wiedergeburt hatte die Gefahr enthalten, den ermorden zu müssen, der man einst gewesen war, und wie viele andere hatte auch Proyas sich entschieden, lieber zu töten als zu sterben.
»Sch«, hatte der Kriegerprophet gesagt. Nur Stunden zuvor war Kellhus vom Umiaki geschnitten worden, und noch immer tränkte Blut die Verbände an seinen Handgelenken mit schwarzen Ringen. »Du musst nicht weinen, Proyas.«
»Aber ich habe versucht, Euch zu töten!«
Kellhus hatte freundlich gelächelt, was in schreiendem Gegensatz
Weitere Kostenlose Bücher