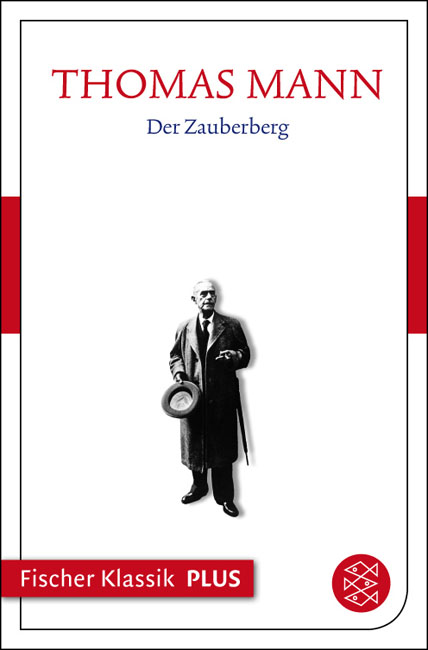![Der Zauberberg]()
Der Zauberberg
Zugeständnisse gemacht habe. Dem mit der Rebellion, der Arbeit und der Kritik oder dem anderen? Es sei ja lebensgefährlich, – ein Teufel rechts und einer links, wie man in’s Teufels Namen da durchkommen solle!
Auf diese Weise, sagte Naphta, sei die Sachlage, wie Herr Settembrini sie zu sehen wünsche, nicht richtig gekennzeichnet. Das Entscheidende in seinem Weltbilde sei, daß er Gott und den Teufel zu zwei verschiedenen Personen oder Prinzi {698} pien mache und »das Leben«, übrigens nach streng mittelalterlichem Vorbilde, als Streitobjekt zwischen sie lege. In Wirklichkeit aber seien sie eins und einig dem Leben entgegengesetzt, der Lebensbürgerlichkeit, der Ethik, der Vernunft, der Tugend, – als das religiöse Prinzip, das sie gemeinsam darstellten.
»Was für ein ekelhafter Mischmasch – che guazzabuglio proprio stomachevole!« rief Settembrini. Gut und Böse, Heiligkeit und Missetat, alles vermengt! Ohne Urteil! Ohne Willen! Ohne die Fähigkeit, zu verwerfen, was verworfen sei! Ob Herr Naphta denn wisse,
was
er leugne, indem er vor den Ohren der Jugend Gott und Teufel zusammenwerfe und im Namen dieser wüsten Zweieinigkeit das ethische Prinzip verneine! Er leugne den
Wert
, – jede Wertsetzung, – abscheulich zu sagen. Schön, es gab also nicht Gut noch Böse, sondern nur das sittlich ungeordnete All! Es gab auch nicht den Einzelnen in seiner kritischen Würde, sondern nur die alles verschlingende und ausgleichende Gemeinschaft, den mystischen Untergang in ihr! Das Individuum …
Köstlich, daß Herr Settembrini sich wieder einmal für einen Individualisten hielt! Um es zu sein, mußte man jedoch den Unterschied von Sittlichkeit und Glückseligkeit kennen, was bei dem Herrn Illuminaten und Monisten schlechterdings nicht der Fall war. Wo das Leben stupiderweise als Selbstzweck angenommen und nach einem darüber hinausgehenden Sinn und Zweck gar nicht gefragt wurde, da herrschte Gattungs- und Sozialethik, Wirbeltiermoralität, aber kein Individualismus, – als welcher einzig und allein im Bereich des Religiösen und Mystischen, im sogenannten »sittlich ungeordneten All«, zu Hause war. Was sie denn sei und wolle, die Sittlichkeit des Herrn Settembrini! Sie sei lebengebunden, also nichts als nützlich, also unheroisch in erbarmungswürdigem Grade. Sie sei dazu da, daß man alt und glücklich, reich und gesund damit {699} werde und damit Punktum. Diese Vernunft- und Arbeitsphilisterei gelte ihm als Ethik. Was dagegen Naphta betreffe, so erlaube er sich wiederholt, sie als schäbige Lebensbürgerlichkeit zu kennzeichnen.
Settembrini ersuchte um Mäßigung, doch war seine eigene Stimme leidenschaftlich bewegt, als er es unerträglich fand, daß Herr Naphta beständig von »Lebensbürgerlichkeit« in einem, Gott wußte, warum, aristokratisch wegwerfenden Tone redete, wie als ob
das Gegenteil
– und man wußte ja, was das Gegenteil des Lebens sei – etwa gar das Vornehmere gewesen wäre!
Neue Schlag- und Stichworte! Jetzt waren sie bei der Vornehmheit, der aristokratischen Frage! Hans Castorp, überhitzt und erschöpft von Frost und Problematik, taumeligen Urteils auch in Hinsicht auf die Verständlichkeit oder fiebrige Gewagtheit seiner eigenen Ausdrucksweise, bekannte mit lahmen Lippen, er habe sich den Tod von jeher mit einer gestärkten spanischen Krause vorgestellt, oder allenfalls, in kleiner Uniform sozusagen, mit Vatermördern, das Leben dagegen mit so einem gewöhnlichen modernen kleinen Stehkragen … Doch erschrak er selbst über das Trunken-Träumerische und Gesellschaftsunfähige seiner Rede und versicherte, nicht dies habe er sagen wollen. Aber ob es sich nicht so verhalte, daß es Leute gebe, gewisse Menschen, die man sich nicht tot vorzustellen vermöge, und zwar, weil sie so besonders ordinär seien! Das solle heißen: dermaßen lebenstüchtig muteten sie an, daß es einem vorkomme, als könnten sie niemals sterben, als seien sie der Weihe des Todes nicht würdig.
Herr Settembrini hoffte sich nicht zu täuschen in der Annahme, daß Hans Castorp dergleichen nur sage, damit man ihm widerspreche. Der junge Mann werde ihn immer bereit finden, ihm in der geistigen Abwehr solcher Anfechtungen zur Hand zu gehen. »Lebenstüchtig« sage er? Und gebrauche dies {700} Wort in einem abschätzig gemeinen Sinn? »Lebenswürdig!« Dieses Wort möge er dafür einsetzen, – und die Begriffe würden sich ihm zu wahrer und schöner Ordnung fügen. »Lebenswürdigkeit«: und sogleich,
Weitere Kostenlose Bücher