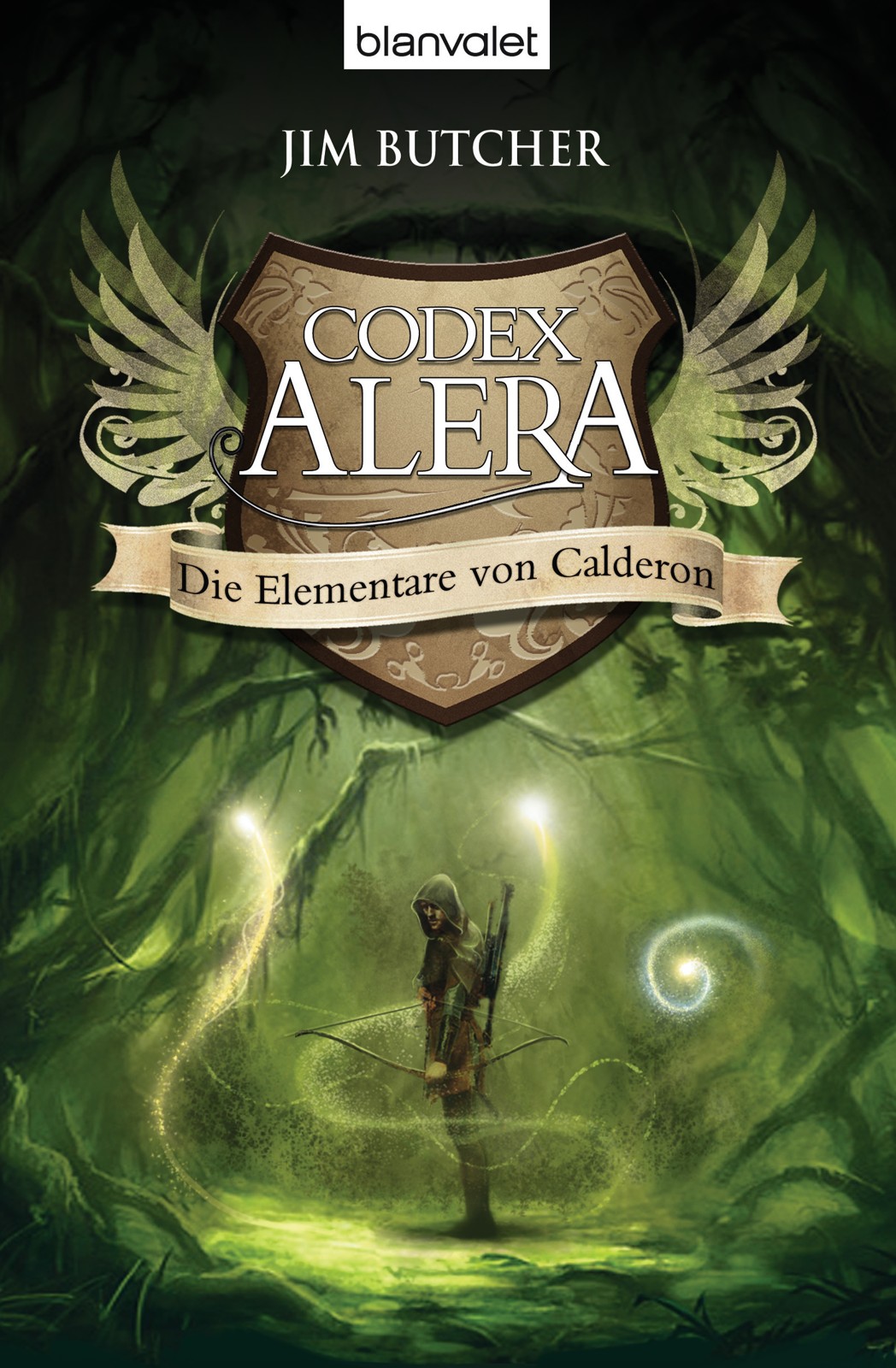![Die Elementare von Calderon]()
Die Elementare von Calderon
Stoff und eine Schere aus der Schale. Er verband die Füße vorsichtig und holte schließlich ein Paar leichte Schuhe mit biegsamen Ledersohlen und graue Wollsocken aus der Schale. Sie wollte protestieren, doch er warf ihr nur einen Blick zu und zog ihr Socken und weiche Schuhe über. »Ganz schön große Füße für eine Frau«, meinte er. »Ich hatte noch ein Paar Schuhe übrig, die erst einmal für eine Weile ihren Dienst tun dürften.«
Schweigend schaute sie ihm zu. »Danke. Wie schlimm ist es denn?«
Er zuckte mit den Schultern. »Für mich sieht es ganz gut aus, doch ich bin kein Wasserwirker. Ich werde meine Schwester bitten, sich die Sache anzuschauen, wenn sie sich besser fühlt.«
Amara legte den Kopf zur Seite. »Ist sie krank?«
Bernard grunzte und stand auf. »Zieh mal den Umhang zurück und kremple den Ärmel hoch. Ich will mir deinen Arm ansehen.«
Amara zog den Umhang nach hinten und versuchte, den Ärmel hochzukrempeln, doch weil die Wunde ganz oben am Arm war, knäulte sich der Stoff und ließ sich nicht ganz hochschieben. Sie versuchte es trotzdem, und der Ärmel drückte in den Schnitt. Der Schmerz schoss durch den Arm, und ihr stockte der Atem.
»Das ist nicht gut«, sagte Bernard. »Wir müssen dir ein anderes Hemd besorgen.« Er nahm die Schere und schnitt den blutigen Ärmel ein Stück oberhalb des Risses ab. Anschließend entfernte er stirnrunzelnd den Verband. Die Falten auf seiner Stirn vertieften sich, als er feststellte, dass sich der Stoff mit der Wunde verklebt hatte. Er schüttelte den Kopf, holte frisches Wasser und ein Tuch und tränkte den Verband, ehe er vorsichtig daran zupfte.
»Wie hast du dir den Arm verletzt?«
Amara strich sich mit der anderen Hand das Haar aus dem Gesicht. »Ich bin gestürzt, gestern, und habe mich geschnitten.«
Bernard antwortete nichts darauf, bis er den alten Verband mit Wasser durchtränkt und vorsichtig abgezogen hatte, ohne die Wunde wieder aufzureißen. Mit ernster Miene und Wasser und Seife säuberte er sie behutsam. Es brannte, und Amara traten die Tränen in die Augen. Sie befürchtete, dass sie vor Erschöpfung und Schmerz einfach zu weinen beginnen könnte. Daher schloss sie die Augen, während er langsam und geduldig seine Arbeit erledigte.
An der Küchentür klopfte es, und eine nervöse Stimme, die
dem Jungen namens Frederic gehörte, fragte: »Herr? Draußen sucht man dich.«
»Ich komme sofort.«
Frederic hüstelte. »Aber, Herr -«
In etwas schärferem Ton sagte der Wehrhöfer: »Sofort, Fred.«
»Ja, Herr«, antwortete der Junge. Die Tür schloss sich wieder.
Bernard beschäftigte sich weiter mit der Wunde und murmelte: »Das müsste eigentlich genäht werden. Oder ein Wasserwirker sollte es schließen. Und du bist gefallen?«
»Ja«, sagte Amara.
»Offensichtlich bist du an einem scharfen Schwert vorbeigefallen«, meinte der Wehrhöfer.
Er säuberte die Wunde und verband sie neu, und obwohl er äußerst behutsam dabei vorging, tat es entsetzlich weh. Am liebsten hätte sich Amara in einen dunklen, stillen Raum zurückgezogen und sich dort zusammengerollt. Stattdessen schüttelte sie den Kopf. »Herr, bitte. Ist die Geschichte des Jungen wahr? Wurdet ihr wirklich von einem Marat angegriffen?«
Bernard holte tief Luft. Er trat ein Stück beiseite, kam zurück und legte ihr eine schwere Decke um die Schultern. »Du stellst eine Menge Fragen, Mädchen. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Und ich weiß nicht, ob du ehrlich mit mir bist.«
»Doch, Herr.« Sie sah ihn an und lächelte.
Ein Mundwinkel bewegte sich nach oben. Er blickte sie an, ehe er sich abwandte und von einem Haken neben dem Waschbecken ein Handtuch holte. »Deine Geschichte finde ich seltsam. Niemand schickt eine Sklavin mit einer so üblen Wunde los, um eine Nachricht zu überbringen. Das ist verrückt.«
Amara errötete. »Er... er wusste es nicht.« Das immerhin entsprach der Wahrheit. »Ich wollte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen.«
»Nein«, erwiderte Bernard. »Mädchen, du siehst überhaupt
nicht aus wie die Sklavinnen, die ich kenne. Vor allem nicht wie die jungen Frauen, die einem Mann dienen.«
Ihr Gesicht wurde immer heißer. »Was willst du damit sagen, Herr?«
Er drehte sich nicht zu ihr um. »Deine Haltung. Wie du errötest, wenn ich dein Bein berühre.« Er blickte über die Schulter. »Nur wenige Menschen würden sich als Sklaven tarnen, denn sie müssen befürchten, für immer Sklaven zu bleiben. Entweder man ist dumm oder
Weitere Kostenlose Bücher