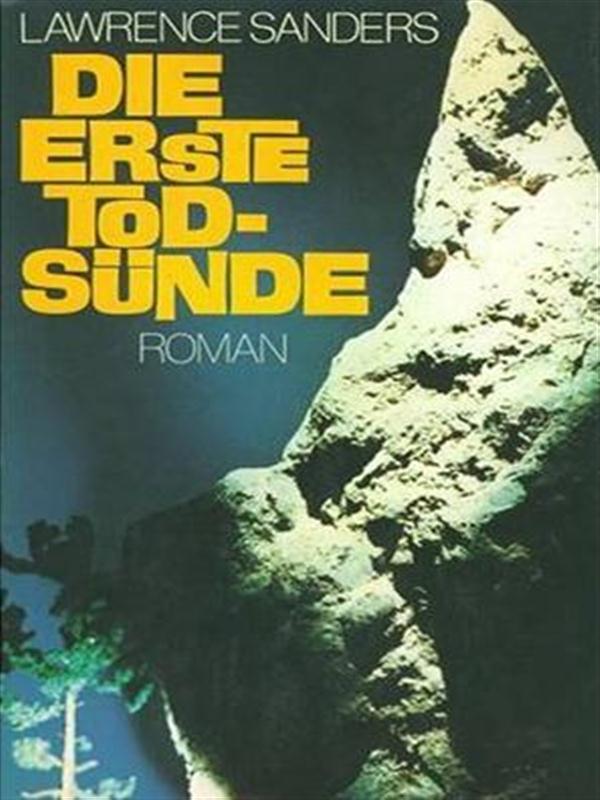![Die erste Todsuende]()
Die erste Todsuende
Schwermütig-Starres, und oft saß er da und brütete vor sich hin. „Was ist denn?" pflegte sie ihn zu fragen, und dann löste er langsam den nach innen gewendeten Blick, richtete ihn auf sie und das Leben und sagte wohl: „Nichts." Bildete er sich denn ein, die strafende Gerechtigkeit für die ganze Welt zu sein?
Nicht, daß er besonders gealtert wäre - eher verwittert und wettergegerbt. Wie sie ihn jetzt in dem grellen Sonnenlicht zusammengesunken dasitzen sah, konnte sie nicht begreifen, warum sie ihn nie „Vater" genannt hatte. Es schien ihr unglaublich, daß er jünger sein sollte als sie. Mit einer dunklen Vorahnung dessen, was auf sie zukam, dachte sie darüber nach, ob er wohl ohne sie leben könne, und kam zu dem Schluß, daß er das schaffen würde. Selbstverständlich würde er sich grämen. Wie benommen und vor den Kopf geschlagen würde er sein. Aber er würde darüber hinwegkommen. Er war heil und ganz.
Methodisch wie er war, hatte er sich Dinge aufgeschrieben, von denen er meinte, daß sie besprochen werden müßten. Er holte sein kleines, ledergebundenes Notizbuch hervor, ließ die Seiten durch die Finger gleiten und setzte dann seine schwere Brille auf.
„Gestern abend habe ich die Kinder angerufen", sagte er ohne aufzublicken.
„Ich weiß, mein Herz. Es wäre mir lieber gewesen, du hättest es nicht getan. Liza hat heute morgen angerufen. Sie wollte herkommen, aber ich habe ihr das ausgeredet. Sie ist schließlich im achten Monat, und ich möchte nicht, daß sie eine so weite Reise macht. Wünschst du dir eigentlich einen Jungen oder ein Mädchen?"
„Einen Jungen."
„Du Schuft! Nun, ich habe ihr gesagt, du würdest sie anrufen, sobald ich's hinter mir hätte; es besteht ja überhaupt kein Grund für sie herzukommen."
„Sehr schön." Er nickte. „Eddie wollte in vierzehn Tagen sowieso kommen, und ich habe ihm gesagt, das wäre schön und er brauchte seine Pläne nicht zu ändern." Er warf einen Blick auf seine Notizen. „...Was hältst du von Spencer?"
Spencer war der Chirurg, mit dem Bernardi sie bekanngemacht hatte: ein kurz angebundener Mann, der sich auf nichts einließ und keinerlei Wärme ausstrahlte. Trotzdem hatte er Delaney durch seine direkten Fragen, raschen Entscheidungen und die Tatsache beeindruckt, daß er Bernardi bei seinem weitschweifigen Gerede brüsk ins Wort gefallen war. Die Operation war für den Spätnachmittag des folgenden Tages angesetzt worden.
„Oh, ich glaube, er ist in Ordnung", sagte Barbara Delaney unbestimmt. „Was hältst denn du von ihm, Lieber?"
„Ich vertraue ihm", sagte Delaney, ohne zu zögern. „Er versteht sein Handwerk. Ferguson sagte mir, Spencer sei ein vorzüglicher Chirurg und ein wohlhabender Mann."
„Das ist gut." Barbara setzte ein schwaches Lächeln auf. „Von einem armen Chirurgen operiert zu werden, würde mir gar nicht gefallen."
Sie schien müde zu werden, und ihre Wangen hatten sich hektisch gerötet. Delaney legte das Notizbuch für einen Augenblick beiseite, um ein Tuch in kaltem Wasser auszuwringen, das er ihr dann liebevoll auf die Stirn legte. Sie wurde bereits intravenös ernährt, und man hatte sie angewiesen, sich so wenig wie möglich zu bewegen.
„Vielen Dank, Lieber", sagte sie mit so leiser Stimme, daß er sie kaum hören konnte. Eilends sah er seine restlichen Notizen durch.
„Nun dann", sagte er, „was soll ich dir morgen mitbringen? Du sagtest, du wolltest den gesteppten blauen Morgenrock haben?"
„Ja", flüsterte sie. „Und die flauschigen rosa Pantoffeln. Sie stehen in der rechten Ecke von meinem Schrank. Meine Füße sind so angeschwollen, daß ich in meine Hausschuhe nicht mehr hineinkomme."
„Mache ich", sagte er munter und machte sich eine Notiz. „Noch was? Kleider, Make-up, Bücher, Obst... irgendwas?"
„Nein."
„Soll ich einen Fernseher für dich mieten?"
Sie gab keine Antwort, und als er hinsah, schien sie zu schlafen. Er nahm die Brille ab, steckte das Notizbuch weg und schickte sich an, auf Zehenspitzen den Raum zu verlassen.
„Bitte", sagte sie mit leiser Stimme, „geh noch nicht. Bleib noch ein paar Minuten bei mir sitzen."
„Solange du möchtest", sagte er. Er zog sich einen Stuhl ans Bett heran, setzte sich und nahm ihre Hand. Lange saßen sie schweigend so da.
„Edward", hauchte sie, ohne die Augen zu öffnen.
„Ja. Ich bin hier."
„Edward."
„Ja", wiederholte er. „Ich bin doch hier."
„Ich möchte, daß du mir etwas versprichst."
„Alles, was du
Weitere Kostenlose Bücher