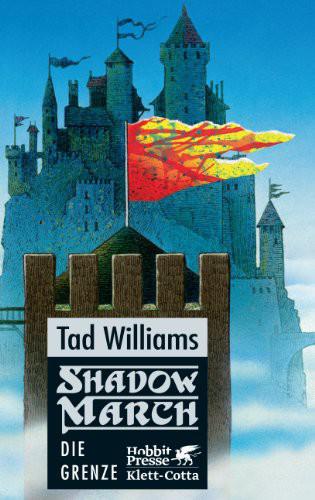![Die Grenze]()
Die Grenze
Männer und andere Schemen, ringend, kämpfend. Einige der Stimmen, die er zuerst für die seiner Gefährten gehalten hatte, riefen und sangen, wie er jetzt erkannte, in einer fremden Sprache. Noch mehr von diesen Lumpenwesen tauchten aus den Büschen auf, aber sie stellten nur einen kleinen Teil der bizarren Kreaturen, die, in ihrem Kauderwelsch schnatternd, durch den Nebel tanzten. Manche Angreifer schienen kaum greifbarer als der Nebel selbst. Noch immer schrien Männer und Pferde, aber die gräßlichen Geräusche wurden jetzt schwächer, als ob sich der Nebel zu etwas verdichtete, das so massiv war wie Stein, oder als ob Raemon selbst in ein Loch gestürzt wäre, das jetzt über ihm zugeschüttet wurde.
Eine Horde winziger, rotäugiger Wesen, die aussahen wie boshafte bärtige Kinder, sprangen aus dem Gras hervor und krallten nach seinen Steigbügeln. Sein Pferd brach durch die Schar der Belagerer und stürmte in wilder Panik davon. Zweige peitschten Raemons Gesicht, und dann war da ein dickerer Ast, der ihn aus dem Sattel hob und zu Boden schleuderte, daß es ihm Atem und Bewußtsein zugleich nahm.
Als er wieder zu sich kam, fühlte er sich wie ein Sack voll zerbrochener Eier. Einen schaurigen Moment lang sah er ein Gesicht aus dem immer noch brodelnden Nebel auf sich herabstarren — ein Gesicht von seltsamer Schönheit, aber so kalt und leblos wie das einer Götterstatue in einem Trigontempel. Er hielt den Atem an, als könnte er so der Aufmerksamkeit des Dämons entrinnen, aber der starrte ihn unverwandt an. Seine Haut war bleich, und die Augen leuchteten wie Kerzenflammen hinter dem dicken Glas eines Tempelfensters. Er hielt das Wesen für männlich, wenn es auch schier unmöglich schien, es mit so simplen, menschlichen Begriffen zu fassen. Dann war es weg, hatte sich einfach in Luft aufgelöst, und der Nebel senkte sich auf ihn herab und verwandelte die Welt in ein einziges Grau.
Raemon Beck kniff die Augen zu, rang nach Luft und wartete auf den Tod. Als er lange genug reglos dagelegen hatte, um sich der Schmerzen in seinem Rücken und seiner Rippengegend, des Hämmerns in seinem Kopf und der unzähligen Kratz- und Schnittwunden in seiner Haut bewußt zu werden, schlug er die Augen wieder auf. Der Nebel war verschwunden. Er lag in einer tiefen, schattigen Senke, aber durch die Blätter über sich sah er blauen Himmel.
Er setzte sich auf und blickte sich um. Die Senke war leer und verlassen.
Beck rappelte sich hoch, bemüht, trotz der Schmerzen keinen Mucks von sich zu geben, und schleppte sich dann den Pfad entlang, den sein Pferd bei der wilden Flucht von der Straße ins Unterholz gebrochen hatte. Von dem Pferd keine Spur. Kein Geräusch von Tieren oder Menschen. Beck machte sich auf das schreckliche Bild gefaßt, das sich ihm bieten würde.
Er erreichte die Straße. Ein Pferd — nicht seins, aber eins, das zur Karawane gehörte — stand dort, als ob es auf ihn wartete. Seine Flanken bebten, aber es war unverletzt und graste am Straßenrand. Als er auf das Pferd zuging, scheute es kurz, ließ sich dann aber streicheln. Es beruhigte sich rasch und graste weiter.
Ungläubiges Entsetzen packte ihn wie eine rohe Hand. Raemon Beck spürte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte, dann würgte er die Überreste seines Morgenmahls hervor. Er wischte sich den Mund ab und kletterte, vor Schmerzen stöhnend, in den Sattel. Seine Gefährten waren so spurlos verschwunden, daß er gar nicht gewußt hätte, wo er anfangen sollte zu suchen. Aber er wollte gar nicht suchen, wollte keinen Augenblick länger an diesem gräßlichen Ort bleiben. Er wollte nur reiten und reiten, bis er eine menschliche Ansiedlung erreichte.
Er wußte, er würde sich nie wieder in diese Hügel wagen. Wenn das hieß, daß er auf seinen Platz im Familienunternehmen verzichten und mit seiner Frau und seinen Kindern auf der Straße um Kupfermünzen betteln mußte, dann war das auch nicht zu ändern.
Er hieb dem Pferd die Fersen in die Flanken und preschte, tief über den Hals des Tiers gebeugt und schluchzend, ostwärts davon.
Es war früher Morgen, und sie konnte nicht schlafen — hatte trotz der ungeheuren Müdigkeit die ganze Nacht kein Auge zugetan. Briony lag im Bett, starrte ins Dunkel und horchte auf die Schlafgeräusche von Moina und Rose und drei weiteren Edelfräulein, die wegen Kendricks morgiger Beisetzung in der Burg übernachteten. Wie konnten sie nur schlafen? Wußten sie denn nicht, daß alles in Gefahr war, daß das
Weitere Kostenlose Bücher