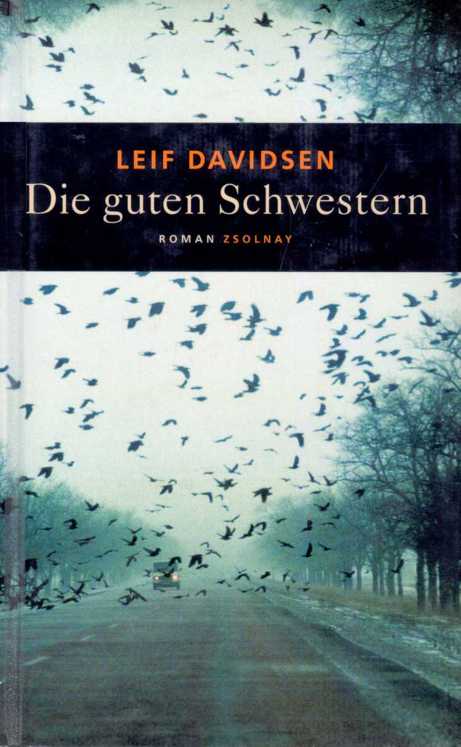![Die guten Schwestern]()
Die guten Schwestern
während ich seinen tiefen Atemzügen lauschte. Ich konnte ihn vor mir sehen: einen kräftig gebauten, älteren Herrn mit etwas zuviel Bauch, der in seinem gemütlichen Wohnzimmer in seinem gemütlichen Eigenheim in einer kleinen Stadt am Meer saß, wo er das Brot herstellte, das ihn zu einem wohlhabenden Mann gemacht hatte. Er und Dorthe hatten zwei Jungen, die beide erwachsen waren und ihren Weg gemacht hatten, wie sie sagten. Hans-Peter fuhr Fisch nach Spanien und Italien. Die bekamen all die guten Rohprodukte, für die wir selbst nicht bezahlen wollten. Der jüngere Bruder Niels war Lehrer in Lemvig und mit der Pastorin des Ortes verheiratet. Sie lebten fernab von allen Kopenhagener Scherereien und waren dieser Typus dänischer Provinzbewohner, der es nicht verstand, daß jemand freiwillig in der Hauptstadt wohnen konnte. Sie sahen Kopenhagen als einen exotischen Ort an, der von rastlosen, verwirrten Menschen sowie verlorenen Jüten und Leuten aus Fünen bevölkert war, die das Schicksal ins Exil getrieben hatte. Kopenhagen entzog der Provinz gutes, ehrlich verdientes Geld. Damit mußte man leben, aber in der Hauptstadt zu leben war eine andere Sache. Das konnten sich ordentliche Menschen nicht vorstellen.
»Wir bleiben in Kontakt«, sagte ich, um das Schweigen zu brechen.
»Das ist ja klar. Wird schon noch werden. Wir kennen doch Irma«, sagte er in seinem sanft singenden Fünisch, das er sich schnell wieder angewöhnt hatte, als er nach Fünen zurückgekommen war.
»Wenn es nur so einfach wäre«, meinte ich, wir sagten im selben Moment auf Wiedersehen, und ich blieb noch ein wenig stehen und schaute auf die Straße und sehnte mich nach Janne und den Kindern. In genau solchen Situationen hatte man wirklich einen Seelenverwandten nötig. Mit dem man seine Sorgen teilen konnte. Ich hätte sie natürlich anrufen können, aber das wollte ich nicht. Janne war tatsächlich ein guter Mensch, den ich ungeheuer mochte, und sie konnte auch zuhören, aber ich wollte es nicht riskieren, den andern an die Strippe zu kriegen.
Ich machte mir ein paar Brote, die ich zusammen mit einer Tüte fettarmer Milch vor den Fernseher mitnahm, während in der Küche der Kaffee durch die Maschine lief. Man berichtete vom Luftkrieg der NATO. Er verlief wie gewöhnlich glänzend. Es waren keine Verluste zu verzeichnen, und die zivilen Verluste auf serbischer Seite seien minimal, sagte ein amerikanischer General. Serbien wurde systematisch ins Steinzeitalter zurückgebombt. Ein dänischer Offizier erklärte, warum es zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendig sein würde, Landtruppen einzusetzen, und dann wurde über den Flüchtlingsstrom in Albanien berichtet. Mehrere trostlose Bilder von leidenden, frierenden Menschen. Aber die Frau aus Preßburg tauchte nicht mehr auf. Falls es das Ziel des Bombardements gewesen war, den Flüchtlingsstrom zu stoppen, war diese Mission bislang ein großes Fiasko. Ich mußte an das Zitat eines US-Offiziers während des Vietnamkriegs denken. »Um das Dorf zu befreien, war es leider nötig, es zu zerstören«, so in etwa hatte er sich über einen kleinen südvietnamesischen Ort geäußert. Das war damals. Jetzt hatte die ganze Angelegenheit etwas Comicartiges. Hoch fliegende, hochtechnologische Kampfjets schickten lasergesteuerte Raketen auf die Reise und flogen zum Abendkaffee nach Italien zurück. Wie es wohl unten auf der Erde zuging? Das würden wir wohl nie erfahren. War der Krieg erst gewonnen, würden die Medien das Interesse verlieren, und die Toten und Verwundeten würden vergessen werden. Bei den Überlebenden bliebe nur der Haß übrig.
Dann klingelte das Telefon. Am anderen Ende erklang eine tiefe Baßstimme, die die Wörter mehr als sorgfältig aussprach:
»Teddy Pedersen? Sie sprechen mit jemandem, der weiß, wer Sie sind. Ich habe gedacht, daß wir uns vielleicht treffen könnten. Es handelt sich um Ihre Schwester.«
Das Fragezeichen hing in der Luft. Mittlerweile gab es nichts mehr, was mich noch überraschen konnte. Warum sollte mich nicht ein Wildfremder anrufen und nach meiner Schwester fragen? Es war ja sowieso nichts mehr so wie noch vor ein paar Wochen.
»Ich habe der Presse nichts zu sagen«, sagte ich barsch.
»Ich bin kein Journalist. Es geht um etwas Persönliches.«
»Ich kenne Sie nicht«, sagte ich.
»Ich glaube, es wäre klug von Ihnen, sich mit mir zu treffen. Wie wär’s mit morgen?«
»Weswegen?«
»Wegen Ihrer Schwester. Es geht um Irma.«
»Das habe ich
Weitere Kostenlose Bücher