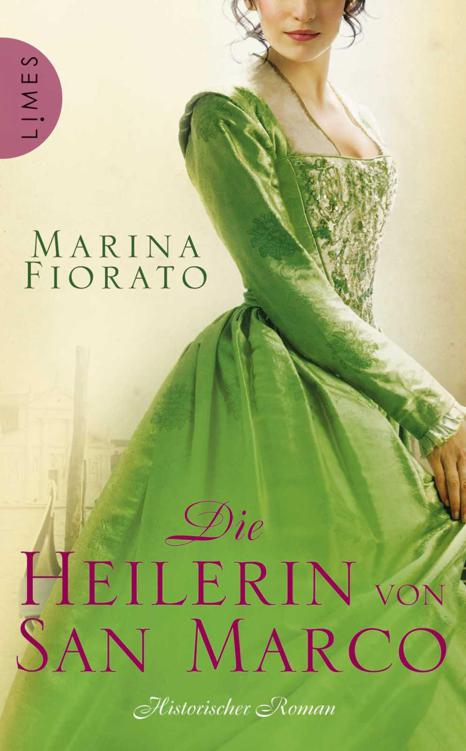![Die Heilerin von San Marco: Historischer Roman (German Edition)]()
Die Heilerin von San Marco: Historischer Roman (German Edition)
zwischen den Ritzen des Rumpfs hindurch. Feyra spähte mit einem Auge durch den breitesten Spalt. Salzige Gischt und Wind trübten ihren Blick, und sie konnte lediglich eine wogende dunkle Wassermasse erkennen. Das Meer, das jetzt nicht mehr so blau wie Lapislazuli und Saphir war, sondern stumpfgrau, bäumte sich wie ein gefährliches Tier auf. Sogar das Wasser war hier anders. Sie hatte alles hinter sich zurückgelassen, was ihr vertraut war. Plötzlich sehnte sich Feyra heftig nach ihrem Vater.
Tränen vermischten sich mit der Gischt, aber sie zwinkerte sie mit vor Erschöpfung schweren Lidern weg. Wieder ganz Ärztin befahl sie sich, sich auszuruhen. Sie war seit dem letzten Morgengrauen auf den Beinen, seit dem eine Welt entfernten Moment, wo sie sich vor ihrem Spiegel so sorgsam angekleidet hatte. Als sie sich zum Schlafen niederlegte, galt ihr letzter bewusster Gedanke dem Vorsatz, morgen den schlingernden Laderaum zu durchqueren und den weißen Vorhang wegzuziehen.
Und festzustellen, was sich Grässliches dahinter verbarg.
Als Feyra erwachte, verspürte sie einen brennenden Durst, vermochte aber zuerst nicht den Kopf zu heben, weil er dröhnte wie eine Trommel. Es kostete sie ebenso viel Mühe wie in der Nacht zuvor, sich aufzusetzen. Damals war sie seekrank gewesen. Jetzt stimmte etwas mit ihrem Körper nicht.
Ihre Haut brannte, sie konnte den Blick nicht auf einen bestimmten Punkt heften, und ihr Kopf drohte zu platzen. Sie musste unbedingt etwas trinken. Verschwommen erinnerte sie sich daran, einen Halbmond aus Regenwasser auf einem der Fässer bemerkt zu haben. Unter Aufbietung all ihrer Willenskraft hob sie die rechte Hand zu dem Deckel des Fasses neben ihr, schloss die Finger um das kupferne Band und tauchte sie in die kleine Pfütze. Dann führte sie die Finger an die Lippen und saugte die kostbare Flüssigkeit auf.
Als sie die Hand zurückzog, stellte sie fest, dass sich die Fingerspitzen schwarz verfärbt hatten. In dem Strahl goldenen Morgenlichts, der durch die Ritzen der Schiffswand fiel, sah sie, dass sie dunkle Flecken aufwiesen, als hätte sie mit Feder und Tinte hantiert. An dem Fass musste Teer geklebt haben. Wieder saugte Feyra an ihren Fingerspitzen, aber die schwarze Färbung blieb.
Die Finger selbst waren pechschwarz angelaufen.
Feyra war mit den Symptomen des Wundbrands vertraut, aber sie hatte keine Verletzung, durch die das Gift in ihren Körper gelangt sein könnte. Da sie nicht länger die Kraft aufbrachte, die Hand vor ihr Gesicht zu halten, ließ sie sie fallen, und dabei schoss ein sengender Schmerz durch ihre Achselhöhle. Mit der anderen Hand befühlte sie die betreffende Stelle über ihrer Brust und ertastete eine runde, feigengroße Schwellung.
Ihre glühende Haut wurde kalt vor Entsetzen. Sie untersuchte den Knoten mit verzweifelten, hektischen Bewegungen. Jede Berührung schmerzte wie ein Messerstich. Konnte es sich um ein Krebsgeschwür handeln, so wie es einige der Konkubinen in der Brust hatten? Nein – sie hatte noch nie erlebt, dass sich eine solche Krankheit über Nacht entwickelte, außerdem lag die besondere Gefahr derartiger Geschwüre darin, dass sie keine Schmerzen verursachten.
Was war es dann? Feyra wusste, dass Achselhöhlen, Leistengegend und Hals während einer Krankheit anschwollen, weil sich die Körpersäfte dort sammelten wie in einer Regenwassertonne, aber so etwas war ihr noch nie untergekommen. Schwach vor Schock sank sie zurück. Ihr Körper fühlte sich wieder an, als stünde er in Flammen, und ihr Schweiß rieselte in die Säcke unter ihr. Von da an nahm sie kaum noch etwas bewusst wahr.
In ihren klaren Momenten registrierte sie benommen, dass Leute kamen und gingen. Jede Nacht wurde eine Lampe in den Laderaum gebracht und an einen Haken gehängt, damit der Quartiermeister seine Vorräte inspizieren konnte, und am Morgen war die Lampe stets wieder verschwunden. Aber bald bekam Feyra all dies nicht mehr mit und konnte nicht mehr verfolgen, wie oft es geschah und wie viele Tage verstrichen waren.
Ab und an hörte sie sich selbst schreien – reden, wirres Zeug plappern, sogar singen. Zu Beginn war sie sich der Notwendigkeit bewusst, sich still zu verhalten, wenn die Deckluke geöffnet wurde, und biss ihre schmerzenden Zähne zusammen. Als die Zeit verging, schwand dieses Bewusstsein, und ihr wurde alles egal. Sie wollte jetzt nur noch, dass jemand sie fand, ihr half und sie zu ihrem Vater brachte, damit sie nicht alleine hier starb und
Weitere Kostenlose Bücher