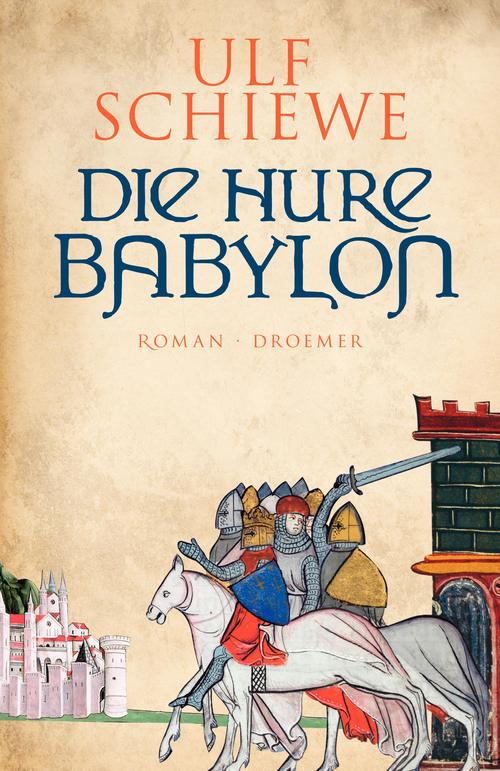![Die Hure Babylon]()
Die Hure Babylon
es still. Schließlich bewegten sich die Büsche vor der Felsspalte und ein hagerer Mann mit wirrem Schopf erschien, bleich, verweint, einen alten Speer in der Hand. Unsicher trat er näher, legte die Waffe auf den Boden. Der Ärmel seines linken Arms war blutgetränkt. Er erhob sich, heftete einen trotzigen Blick auf Raol und nahm die Schultern zurück.
»Meiner Familie soll es gutgehen.« Er wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht. »Ihr habt es versprochen, Herr.«
Raol nickte.
»Ihr habt es versprochen«, sagte Loris noch einmal, eindringlicher als zuvor.
Simon, der Kriegsknecht, wollte ihn binden, aber Raol untersagte es, da der Mann die Hände frei für den Abstieg brauchen würde. Sie nahmen ihn in die Mitte. Er schien sich in sein Schicksal ergeben zu haben. Doch als sie den Weg ins Tal einschlagen wollten, griff er plötzlich in sein Hemd und riss ein Messer heraus.
»Ich will nicht hängen!«, schrie er wie von Sinnen.
Und bevor jemand eingreifen konnte, hatte er sich selbst mit einem Ruck von Ohr zu Ohr die Kehle durchschnitten. Die Männer standen gelähmt vor Schreck. Loris selbst starrte fast ungläubig an sich herunter, als das Blut in einem Schwall aus der schrecklichen Wunde sprudelte, im Nu den Kittel durchtränkte und über die Stiefel auf den Boden rann. Dann schwankte er, verdrehte die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war, und sank langsam nieder. Eine Weile noch zuckte sein Leib, während das Blut aus ihm strömte und die Erde dunkel färbte. Dann regte er sich nicht mehr.
»Putan merda!«,
entfuhr es Raol. »So ein Esel.«
Seine Lippen waren weiß, die Stirn finster vor Zorn.
Lange Zeit sagte niemand etwas. Selbst die Hunde wagten keinen Laut von sich zu geben. Dann zerrten die Männer den Leichnam in die Felsspalte und bedeckten ihn mit Steinen, um ihn vor wilden Tieren zu schützen. Raol würde Leute aus dem Dorf schicken, um die sterblichen Reste zu bergen. Auch wenn er sich selbst gerichtet hatte, sollte Loris ein christliches Begräbnis haben.
Auf dem Rückweg sprachen die Männer kein Wort, bis sie wieder bei den Pferden angekommen waren.
»Hättest du ihn gehängt?«, fragte Arnaut.
Sein Onkel blickte ihn abschätzend an. Der Mund war hart, als er antwortete. »Verdient hätte er es. Aber vielleicht hätte ich ihn auch dazu verdammt, mit dir zu ziehen.«
»Mit mir? Wohin?«
»Auf euren blödsinnigen Heerzug nach Outremer. Redet doch alle Welt davon.«
»Wer sagt, ich nehme das Kreuz?«
»Weil du aussiehst wie einer, der auf Ruhm und Ehre hält. Und zu jung, um zu wissen, wie wenig sie wert sind.«
Damit kehrte er seinem Neffen den Rücken zu und zog sich fußmüde in den Sattel.
♦
Der Kastellan und seine Wachmänner schlugen den Weg zum Hof der Witwe ein, um ihr die Nachricht vom Tode ihres Mannes zu überbringen.
Schweigend kehrten die Übrigen zur Burg zurück. Auch Arnaut war nicht nach Reden zumute. Was Gustau betraf, der sprach ohnehin selten, und die jungen Männer aus dem Dorf, die als Hundeführer dienten, trauten sich nicht, in Arnauts Gegenwart den Mund aufzutun.
Der Tod des Bauern hatte Arnaut getroffen. Lag die Schuld allein bei den Mönchen von Cubaria? Oder hätte Onkel Raol sich anders verhalten sollen? Aber schließlich hatte dieser Loris einen Mann erschlagen. Das Recht musste gewahrt werden. Ohne Recht würde alle Ordnung zusammenbrechen.
Andererseits hatte Loris zur
familia
gehört, und die war gegen Außenstehende zu verteidigen. Den Mönchen stand es nicht zu, ohne Zustimmung des Burgherrn einem von Rocaforts Bauern das letzte Brot aus dem Mund zu stehlen, auch wenn dieser ihnen den Zehnten schuldete. Die Sache würde noch ein Nachspiel haben. Hatte Raol deshalb sein Urteil mildern und den Mann zum Kriegsdienst im Pilgerheer verpflichten wollen?
Die scharfen Worte über Ruhm und Ehre nahm Arnaut ihm nicht übel. Das war Raols Art und nicht bös gemeint. Auf seine Ehre als Ritter und Edelmann ließ Arnaut nichts kommen, aber Ruhm? Danach verlangte es ihm nicht.
Das Ende dieses einfachen Mannes gab ihm jedoch zu denken. Ein Tod ohne Sinn, vielleicht sogar ein Leben ohne Sinn. Bei diesem Gedanken spürte er wieder das leichte Unbehagen, eine undeutliche Unzufriedenheit mit sich selbst, die sich seit geraumer Zeit in sein Herz geschlichen hatte, ohne dass er dafür den genauen Grund hätte nennen können.
Dabei ging es ihm gut. Es war vor Jahren ein glücklicher Zufall gewesen, der ihn und seinen Freund Severin nach Narbona
Weitere Kostenlose Bücher