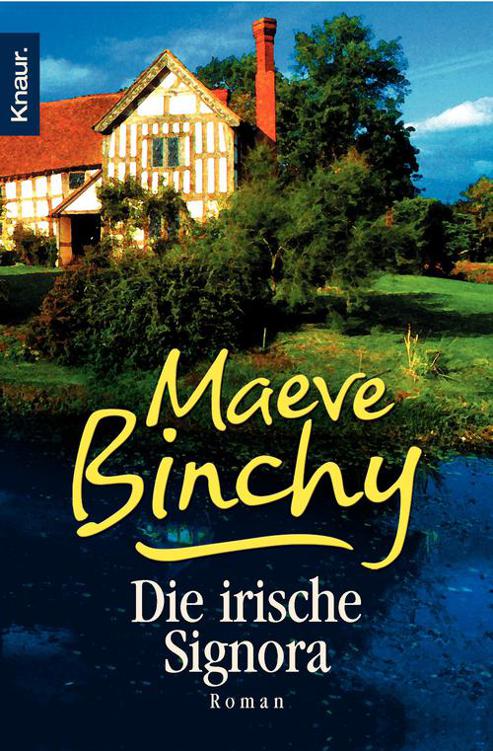![Die irische Signora]()
Die irische Signora
überzeugt, daß sie bald die Heimreise antreten würde.
Doch die Signora hatte kein Heim, wo man auf sie wartete, sie wollte nicht fort. Immerhin hatte sie, die jetzt schon über fünfzig war, seit mehr als zwanzig Jahren hier gelebt. Und hier wollte sie auch sterben. Eines Tages würde die Glocke auch zu ihrem Begräbnis läuten, das Geld für ihre Beerdigung hatte sie schon in einem kleinen Holzkästchen mit Schnitzereien bereitgelegt.
Und so achtete sie nicht auf die immer unverblümteren Andeutungen.
Bis Gabriella zu ihr kam.
In dunkler Trauerkleidung überquerte Gabriella den Platz. Sie wirkte gealtert, Kummer und Gram hatten tiefe Spuren in ihr Gesicht gegraben. Sie war noch nie in den Zimmern der Signora gewesen. Doch sie klopfte an die Tür, als ob man sie erwartete. Die Signora hantierte nervös herum, um ihren Gast zu bewirten, sie bot Gabriella Fruchtsaft und Wasser an und einen Keks aus der Dose. Dann setzte sie sich und wartete.
Gabriella durchmaß die beiden Räume. Sie strich über die Steppdecke auf dem Bett mit all den kunstvoll eingestickten Ortsnamen.
»Eine erlesene Arbeit, Signora«, lobte sie.
»Sehr freundlich, Signora Gabriella.«
Danach herrschte langes Schweigen.
»Werden Sie bald zurück in Ihre Heimat fahren?« fragte Gabriella schließlich.
»Niemand wartet dort auf mich«, erwiderte die Signora schlicht.
»Aber hier gibt es doch auch keinen, dem zuliebe Sie bleiben wollen. Jetzt nicht mehr.« Gabriella war nicht minder direkt.
Die Signora nickte, als wollte sie ihr recht geben. »Aber in Irland, Signora Gabriella, habe ich überhaupt niemanden. Ich bin hierher gekommen, als ich noch ein junges Mädchen war, jetzt bin ich eine Frau in mittleren Jahren, an der Schwelle zum Alter. Ich möchte hierbleiben.« Ihre Blicke kreuzten sich.
»Sie haben hier doch keine Freunde, kein erfülltes Leben, Signora.«
»Ich habe hier mehr als in Irland.«
»In Irland könnten Sie die alten Bekanntschaften auffrischen. Ihre Freunde und ihre Familie würden sich über Ihre Rückkehr bestimmt freuen.«
»Wollen Sie denn, daß ich fortgehe, Signora Gabriella?« fragte die Signora schließlich ohne Umschweife. Sie wollte es einfach wissen.
»Er hat immer gesagt, daß Sie gehen würden, wenn er sterben sollte. Er hat gesagt, daß Sie zu Ihren Leuten zurückgehen würden und mich hier im Kreis meiner Lieben meinen Ehemann betrauern ließen.«
Überrascht blickte die Signora sie an. Mario hatte dieses Versprechen in ihrem Namen gegeben, ohne sie zu fragen. »Hat er behauptet, ich sei damit einverstanden?«
»Er hat gesagt, daß es so kommen würde. Und daß er Sie nicht heiraten würde, falls ich, Gabriella, zuerst sterben sollte, weil das einen Skandal auslösen und mein Ansehen schmälern würde. Weil man dann denken könnte, daß er von jeher eigentlich Sie hatte heiraten wollen.«
»Und waren Sie froh darüber?«
»Nein, ganz und gar nicht, Signora. Weil ich mir nicht vorstellen mochte, wie es ist, wenn Mario tot ist oder ich sterbe. Aber es gab mir wohl die notwendige Würde. Ich brauchte Sie nicht zu fürchten. Sie würden nicht gegen jede Tradition verstoßen und hierbleiben, um mit uns den Verblichenen zu betrauern.«
Draußen auf dem Platz ging das Leben seinen gewohnten Gang: Fleisch wurde ins Hotel geliefert, ein Lieferwagen mit Ton rumpelte zur Töpferwerkstatt, Kinder kamen lachend und kreischend aus der Schule. Hunde bellten, und irgendwo zwitscherten sogar Vögel. Mario hatte mit ihr über Würde und Tradition gesprochen und wie wichtig diese Dinge für ihn und seine Familie waren.
Daher glaubte sie, seine Stimme aus dem Jenseits zu hören. Er sandte ihr eine Nachricht, er bat sie, nach Hause zu fahren.
Sie sprach betont langsam: »Voraussichtlich Ende des Monats, Signora Gabriella. Ich werde wohl Ende des Monats nach Irland zurückkehren.«
In den Augen der anderen Frau spiegelten sich Dankbarkeit und Erleichterung. Sie streckte ihre Hände aus und umfaßte die der Signora. »Bestimmt werden Sie dort sehr viel glücklicher sein und Ihren Frieden finden«, meinte sie.
»Ja, gewiß«, erwiderte die Signora gedehnt. Die Worte klangen in der warmen Luft des Nachmittags lange nach.
»
Si, si, … veramente.«
Sie besaß kaum genug Geld, um die Heimreise zu bezahlen. Aber offenbar wußten ihre Freunde das.
Und so kam Signora Leone und drückte ihr ein Bündel Lirescheine in die Hand. »Bitte, Signora, bitte. Schließlich verdanke ich Ihnen meinen geschäftlichen Erfolg.
Weitere Kostenlose Bücher