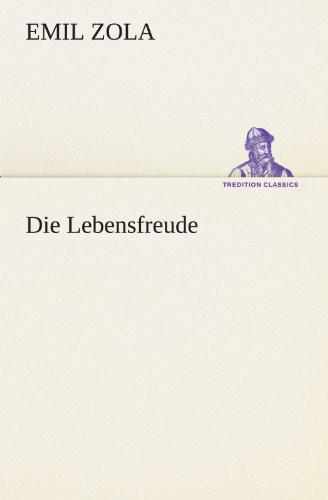![Die Lebensfreude]()
Die Lebensfreude
sie sollten nicht zu sehr klagen, da es schon eine Gnade für sich und die Seinen sei, wenn man sich nicht selbst sterben sehe.
Die erste Nacht wurde für Pauline sehr hart. Sie hatte, auf einen Lehnsessel halb hingestreckt, nicht schlafen können, die Ohren sausten ihr von den starken Atemzügen der Sterbenden. Sowie sie einzuschlafen begann, schien es ihr, als erzittere das Haus von diesem Hauche, als müsse alles davon bersten. Hatte Pauline dagegen die Augen offen, so wurde sie von Beklemmungen befallen und durchlebte nochmals alle die Qualen, die ihr seit einigen Monaten das Leben vergiftet hatten. Selbst zur Seite dieses Sterbelagers ward nicht Frieden in ihr, es war ihr unmöglich zu vergeben. In diesem Alpdrücken der düstern Nachtwache litt sie besonders unter Veronikas Geständnissen. Ihre Heftigkeit von ehemals, ihr eifersüchtiger Groll erwachten bei den Einzelheiten, die sie unter Qualen sich wieder ins Gedächtnis rief. Mein Gott! Nicht mehr geliebt zu werden, sich von denen verraten zu sehen, die man liebt, allein dazustehen, das Herz voller Verachtung und Empörung! Die frisch geöffnete Wunde blutete von neuem; nie zuvor hatte sie Lazares Schimpf bis zu diesem Grade verspürt. Hatte man sie getötet, so konnten nun auch die anderen sterben. Immer wieder tauchte der Raub an ihrem Gelde und an ihrem Herzen vor ihr auf unter dem Banne der starken Atemzüge ihrer Tante, die ihr schließlich die Brust zu sprengen drohten.
Tagsüber blieb sie niedergeschlagen. Die Zuneigung kehrte nicht zurück, nur die Pflicht hielt sie noch an dieses Zimmer gebannt. Das aber machte sie vollends unglücklich: stand sie denn auch im Begriff, schlecht zu werden? In dieser Unruhe verstrich der Tag. Pauline bemühte sich unzufrieden mit sich selbst um die Kranke, abgestoßen von ihrem Mißtrauen. Diese nahm ihre Zuvorkommenheiten mit Brummen auf, verfolgte sie mit argwöhnischem Auge und schaute ihr nach, um zu sehen, was sie tat. Verlangte sie ein Taschentuch, beroch sie es erst vor dem Gebrauch, und wenn sie sie eine Flasche warmes Wasser bringen sah, wollte sie erst die Flasche betasten.
»Was hat sie nur?« fragte das junge Mädchen leise die Magd. »Glaubt sie, ich wäre fähig, ihr etwas Böses zu tun?«
Als Veronika nach Abfahrt des Arztes Frau Chanteau einen Löffel voll Medizin reichte, bemerkte diese nicht die Nichte, die gerade Wäsche im Schranke suchte und flüsterte:
»Hat der Arzt die Medizin bereitet?«
»Nein, das Fräulein.«
Nun kostete sie mit dem Rand der Lippen, dann schnitt sie ein Gesicht.
»Das schmeckt nach Kupfer... Ich weiß nicht, was sie mich zu nehmen zwingt; ich habe seit gestern einen Kupfergeschmack im Magen.«
Mit einer jähen Bewegung schüttete sie den Inhalt des Löffels hinter das Bett. Veronika stand mit offenem Munde da.
»Nun! Was ist. denn los? Ist das ein Gedanke!« »Ich habe noch keine Lust abzufahren«, sagte Frau Chanteau und ließ den Kopf auf das Kissen sinken. »Höre, meine Lunge ist noch stark. Sie könnte sehr wohl noch vor mir die Reise antreten, denn sie steckt gerade nicht in einer gesunden Haut.«
Pauline hatte die Worte gehört. Ins Herz getroffen, wandte sie sich um und schaute Veronika an. Statt einen Schritt vorwärts zu machen, wich sie noch mehr zurück, sie schämte sich für ihre Tante wegen dieses verabscheuungswürdigen Verdachtes. Es ging eine plötzliche Veränderung in ihr vor; angesichts dieser von Furcht und Haß durchwühlten Unglücklichen kam ein tiefes Mitleid über sie, und weit entfernt, ihr darob zu grollen, fühlte sie sich von einer schmerzlichen Rührung übermannt, als sie sich bückte und unter dem Bette die Arzneien erblickte, welche die Kranke, aus Furcht vor Gift dort hinwarf. Bis zum Abend zeigte sie ihr eine ungetrübte Freundlichkeit; sie schien nicht einmal die unruhigen Blicke zu bemerken, die ihre Hände prüften. Ihr brennender Wunsch war, durch eine gütige Sorgfalt die Befürchtungen der Sterbenden zu besiegen, sie diesen schauderhaften Verdacht nicht in die Erde mitnehmen zu lassen. Sie verbot Veronika, durch die Erzählung dieses Vorfalls Lazare noch mehr zu erschrecken.
Seit dem Morgen hatte Frau Chanteau nur ein einziges Mal nach ihrem Sohne gefragt und sich mit der ersten besten Antwort begnügt, ohne über seine Abwesenheit des weiteren erstaunt zu sein. Übrigens sprach sie noch weniger von ihrem Manne; es beunruhigte sie nicht im Geringsten, was er so allein im Speisezimmer tun könne. Alles verschwand für
Weitere Kostenlose Bücher