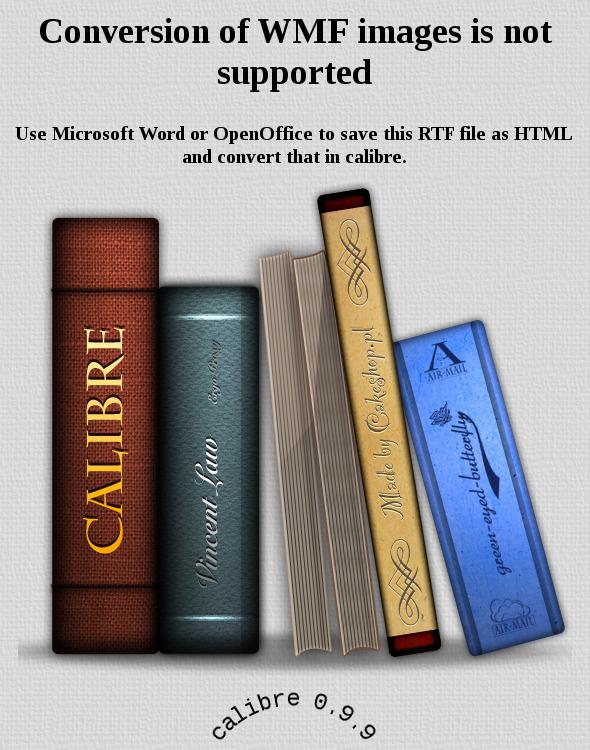![Die Liebe in den Zeiten der Cholera]()
Die Liebe in den Zeiten der Cholera
anderen gekannt hatte, der ihn aufgezogen und unterrichtet hatte, der zweiunddreißig Jahre lang mit Juvenals Mutter geschlafen hatte und sich ihm dennoch, schlicht und einfach aus Schüchternheit, erst in jenem Brief mit Leib und Seele zu erkennen gegeben hatte. Bis dahin hatten Doktor Juvenal Urbino und seine Familie den Tod als ein Mißgeschick angesehen, das anderen widerfuhr, den Vätern der anderen, deren Brüdern und Ehegatten, das aber nicht die eigene Familie traf. Sie selbst waren Menschen, die langsam lebten, man sah sie weder alt noch krank werden, sie starben auch nicht, sondern verflüchtigten sich nach und nach, wurden zu Lebzeiten Erinnerungen, Nebel aus einer anderen Zeit, bis das Vergessen sie aufsog. Der Abschiedsbrief seines Vaters ließ ihn, mehr noch als das Telegramm mit der bösen Nachricht, auf die Gewißheit des Todes prallen. Dabei war eine seiner ältesten Erinnerungen, damals war er neun oder elf Jahre alt gewesen, ein früher Hinweis auf den Tod in der Person seines Vaters gewesen. Beide waren an einem Regennachmittag in der Offizin des Hauses geblieben. Der kleine Juvenal malte mit bunten Kreiden Lerchen und Sonnenblumen auf die Bodenfliesen, sein Vater saß lesend im Gegenlicht des Fensters, er hatte die Weste aufgeknöpft und Gummibänder an den Hemdsärmeln. Auf einmal unterbrach er die Lektüre, um sich mit einem Silberhändchen an langem Stil den Rücken zu kratzen. Da es ihm nicht gelang, bat er den Sohn, ihn mit den Nägeln zu kratzen. Der tat es und war seltsam berührt davon, beim Kratzen nicht den eigenen Leib zu spüren. Am Ende lächelte ihn der Vater traurig über die Schulter an. »Wenn ich jetzt sterbe«, sagte er zu ihm, »wirst du dich kaum mehr an mich erinnern, wenn du so alt bist wie ich.«
Er sagte es ohne ersichtlichen Grund, und für einen Augenblick schwebte der Todesengel durch das kühle Dämmerlicht des Raums, verschwand dann wieder durch das Fenster, eine Federspur zurücklassend. Doch das Kind sah sie nicht. Mehr als zwanzig Jahre waren seitdem vergangen, und Juvenal Urbino würde bald das Alter seines Vaters an jenem Nachmittag erreicht haben. Er wußte, daß er ihm glich, und zu diesem Wissen war nun das erschreckende Bewußtsein gekommen, sterblich zu sein wie er.
Die Cholera wurde ihm zur Obsession. Er wußte über diese Krankheit nicht viel mehr als das routinemäßig in einem Nebenkurs Gelernte, er hatte kaum glauben mögen, daß sie vor knapp dreißig Jahren in Frankreich, sogar in Paris, über hundertvierzigtausend Tote gefordert hatte. Nach dem Tod seines Vaters lernte er jedoch alles über die diversen Erscheinungsformen der Cholera, was nur zu lernen war, eine Art Buße, um sein Gewissen zu beschwichtigen. Er wurde Schüler von Professor Adrien Proust, dem bedeutendsten Epidemiologen seiner Zeit, der die sanitären Kordons erfunden hatte und der Vater des großen Romanciers war. Als Juvenal Urbino in seine Heimat zurückkehrte und schon von See aus den abscheulichen Gestank des Marktes, dann die Ratten in der offenen Kanalisation sah und die Kinder, die sich nackt im Straßenschlamm wälzten, war ihm nicht nur klar, wie es zu dem Unglück hatte kommen können, sondern er wußte auch, daß es sich jeden Augenblick wiederholen konnte. Es dauerte nicht lang. Noch bevor ein Jahr vergangen war, baten ihn seine Schüler am Hospital de la Misericordia um Hilfe bei einem Kranken, dessen ganzer Körper eigentümlich blau verfärbt war. Doktor Juvenal Urbino genügte ein Blick von der Tür aus, um den Feind zu erkennen. Doch man hatte noch Glück: Der Kranke war drei Tage zuvor auf einem Schoner aus Curacao angekommen und hatte von sich aus die Ambulanz des Hospitals aufgesucht, so schien es nicht wahrscheinlich, daß er jemanden angesteckt hatte. Doktor Juvenal Urbino warnte für alle Falle seine Kollegen. Er erreichte, daß die Behörden die Nachbarhäfen alarmierten, damit der infizierte Schoner geortet und in Quarantäne gelegt würde, und mußte mäßigend auf den örtlichen Militärkommandanten einwirken, der das Kriegsrecht ausrufen und sogleich die Therapie des viertelstündlichen Kanonenschusses einleiten wollte.
»Sparen Sie sich das Pulver, bis die Liberalen kommen«, riet er ihm gutgelaunt. »Wir leben nicht mehr im Mittelalter.« Der Kranke starb nach vier Tagen, erstickt an weißkörnig Erbrochenem. In den folgenden Wochen wurde aber trotz ständiger Alarmbereitschaft kein weiterer Fall entdeckt. Wenig später berichtete die Zeitung Diario
Weitere Kostenlose Bücher